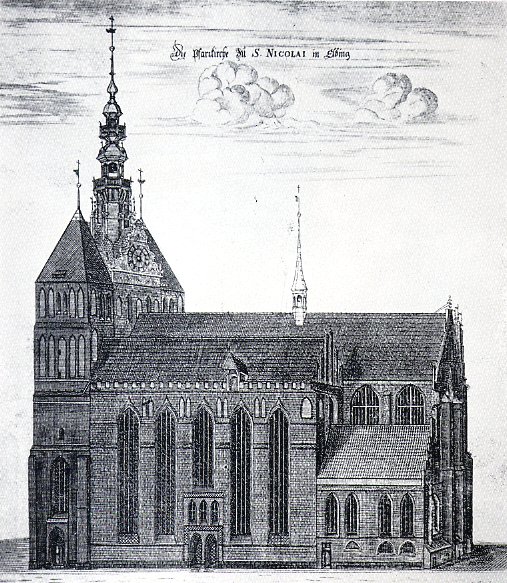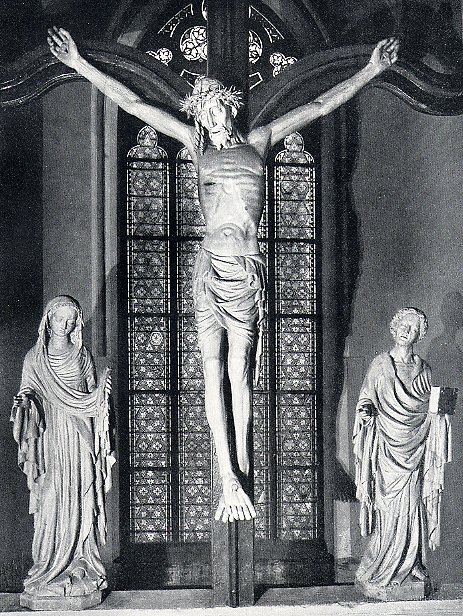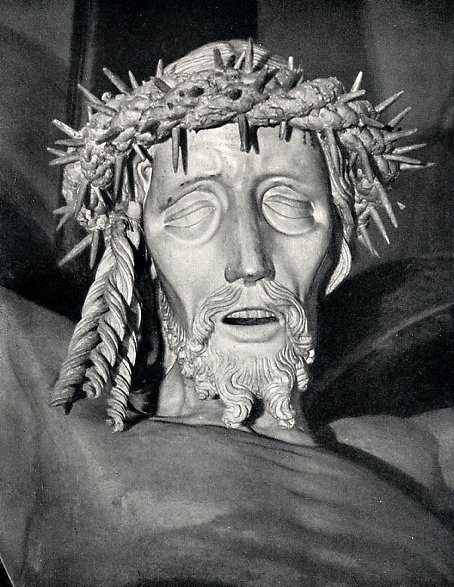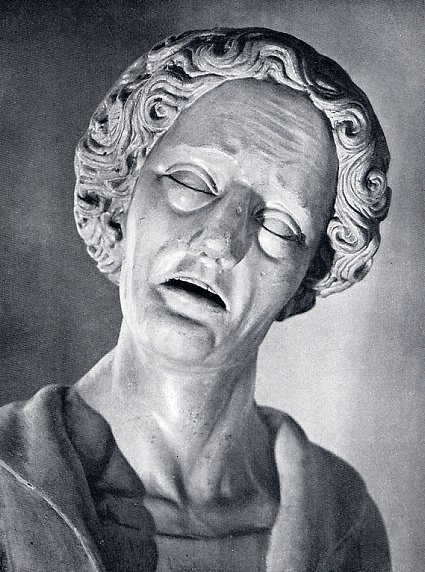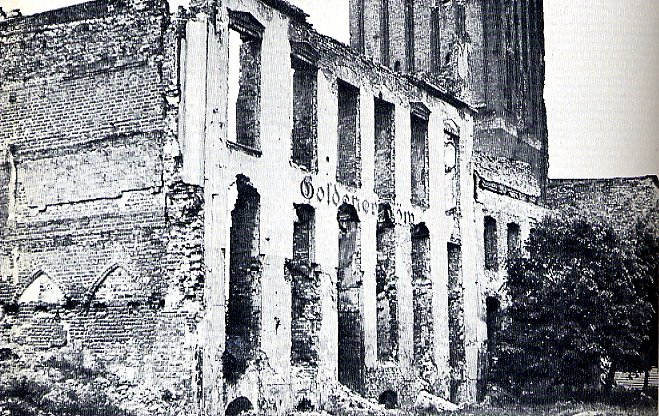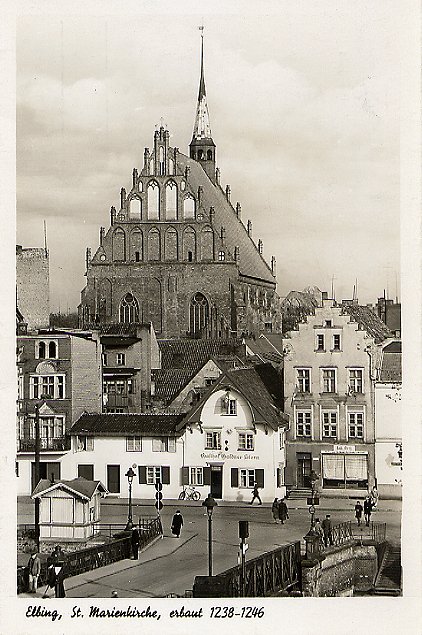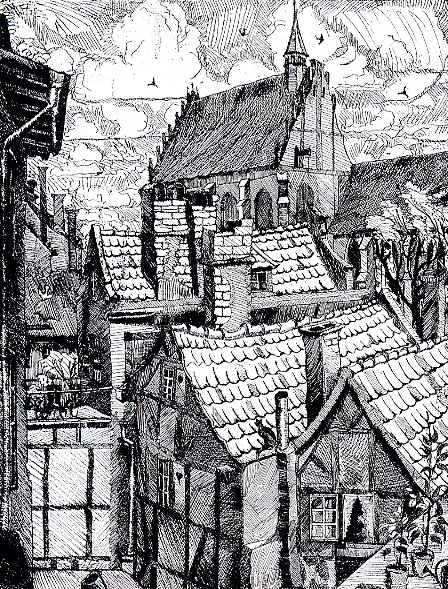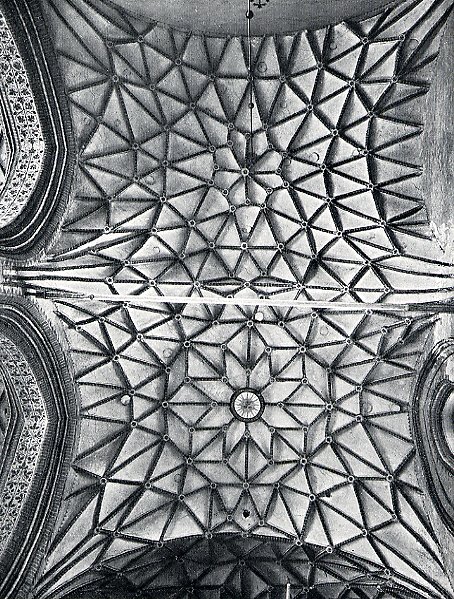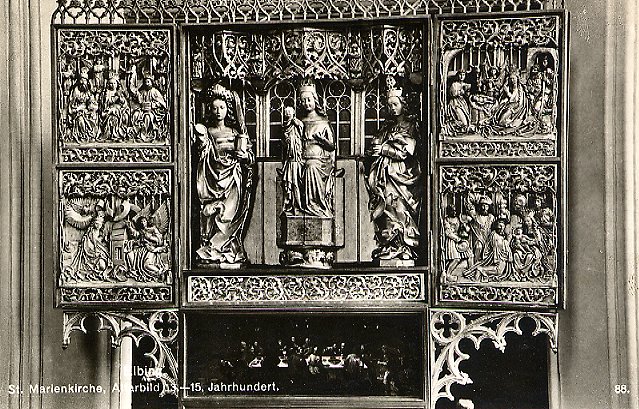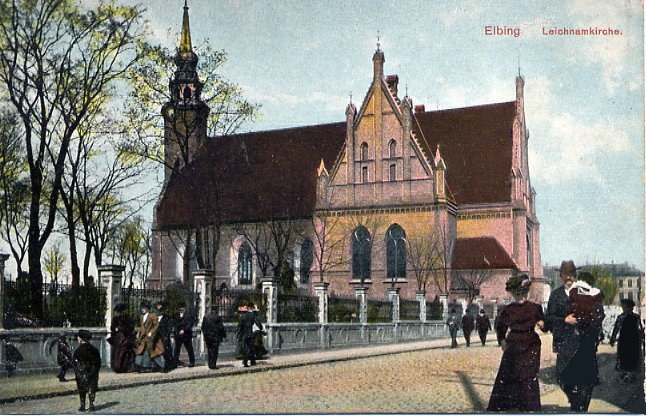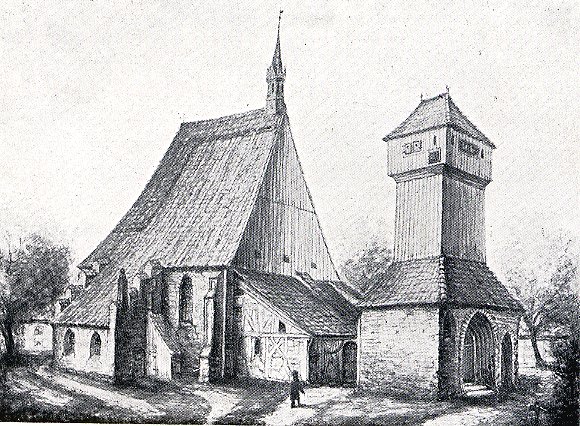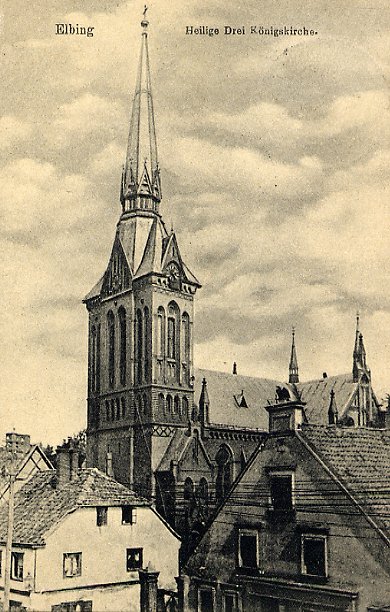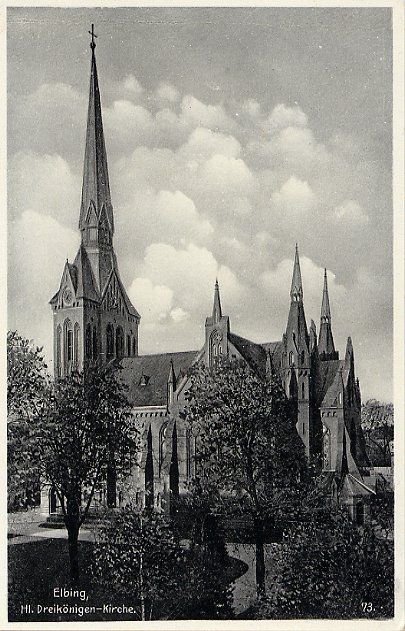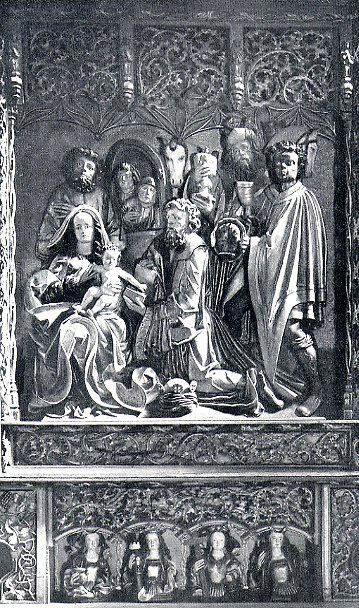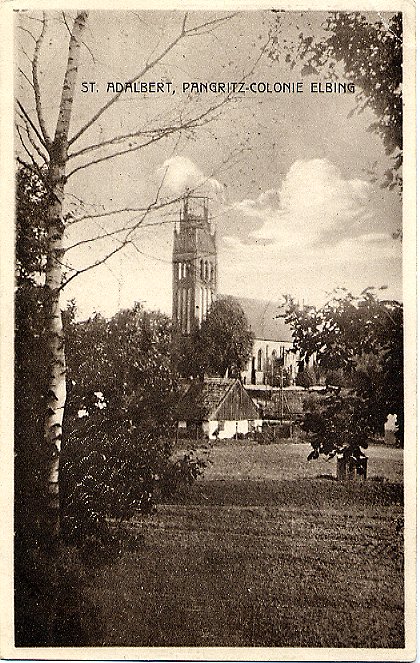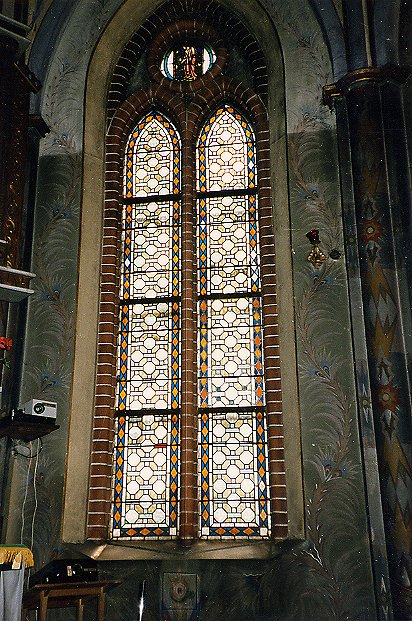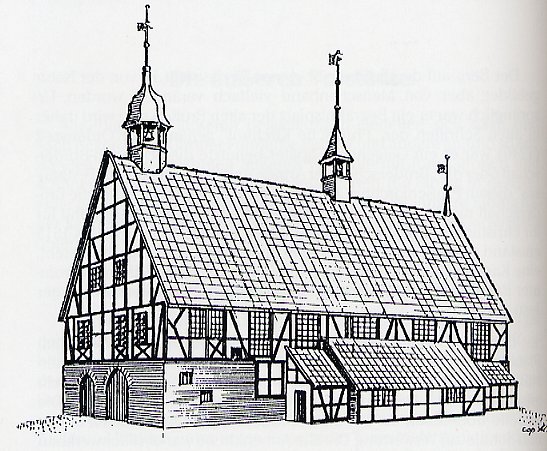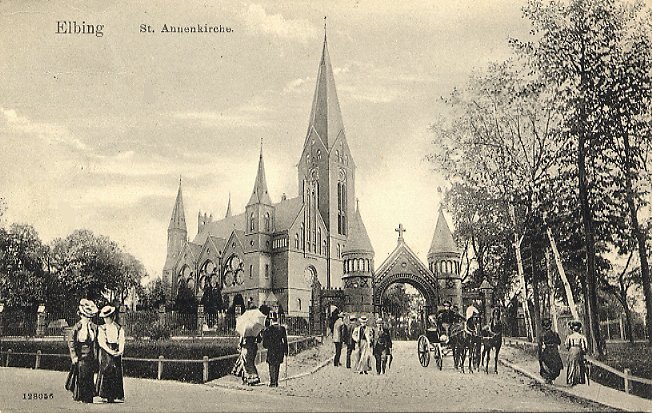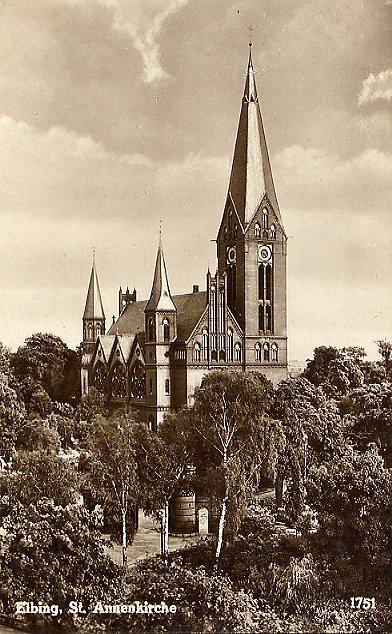|
Westpreußische Kirchen
von Christa Mühleisen
Elbing
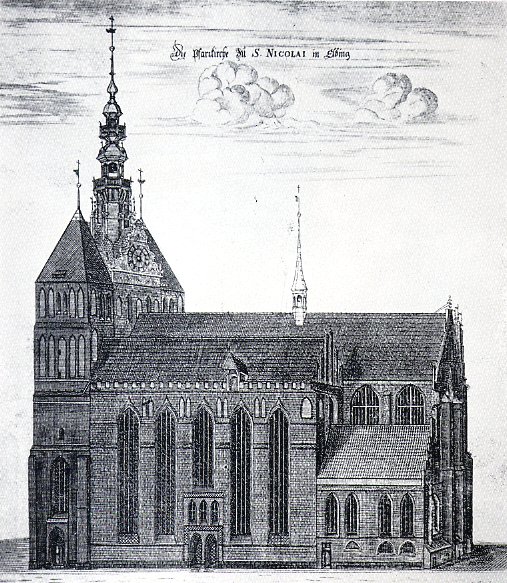
Bild Nr. 1: Pfarrkirche St. Nikolai. Kupferstich von
Joh. Friedrich Enders (um 1737). Der Helm wurde 1598-1603 errichtet. Der
Kupferstich befand sich in der Stadtbibliothek in Elbing.
Damit die ersten Ansiedler Elbings,
meistens Lübecker Bürger und Siedler westfälischer Abstammung, eine
religiöse Betreuung erhalten und an den Gottesdiensten teilnehmen
konnten, wurde etwa um 1240 eine kleine einschiffige Kirche errichtet
und dem Schutzpatron der Seefahrer und Schiffer, dem heiligen Nikolaus
geweiht. 1246 wurde als erster Pfarrer "Godefridus" erwähnt.
Da
die Bevölkerung seit dem Ende des 13. Jahrhunderts gewachsen war, wurde
der erste Bau zu klein, so daß bald nach 1260 eine dreischiffige
Hallenkirche im gotischen Stil erbaut wurde. Vor dem Brand war sie eine
der schönsten Kirchen in Deutschland. Sie hatte nach dem Vorbild des
Lübecker Domes zwei stattliche Seitentürme, zwischen denen sich aber
erst nach dem Jahr 1564, "der grüne Turm" erhob.
Dieser
geriet am 26. April 1777 durch einen Blitzschlag in Brand. Durch den
Einsturz des Hauptturmes wurde das dreiteilige Kirchendach zertrümmert
und selbst das benachbarte Rathaus am Markt in Brand gesetzt. Bei dem
Aufbau der Kirche wurden alle drei Schiffe unter ein Dach (Walmdach)
gezogen und die Seitenmauern um 6 Meter erniedrigt. Anstelle der
Gewölbedecke wurde eine Balkendecke angebracht. Die Seitentürme wurden
abgebrochen und der mittlere Turm erst 1907 wieder aufgebaut. Mit einer
Höhe von 96 Metern war er der höchste und schönste Turm Elbings.

Bild Nr. 2: Brückstraße mit
Blick auf die St. Nikolaikirche und den Turm von 1907 (links das
Gasthaus zum Goldenen Löwen).

Bild Nr. 3: Blick vom Turm der Nikolaikirche. Das lange Gebäude
am Elbingfluß mit dem kleinen Türmchen ist die Agnes-Miegel-Schule.
Das
Innere der Kirche machte mit seinem hohen, schlanken Säulenbau einen
imposanten Eindruck. Der Hochaltar ist ein stattlicher Rokoko-Altar
(1754) des Bildhauers Christoph Perwanger aus Tolkemit. Nach dem großen
Brand wurde er 1778-90 in der Form des früheren Altars von dem
Bildhauer Benjamin Schulz aus Heilsberg erneuert. Bemerkenswert sind
auch die aus Holz geschnitzten Statuen des Heiligen Nikolaus, des
Schutzpatrons der Kirche und die zehn Apostel, die bei dem Brand sowie
auch 1945 gerettet werden konnten. Ein spätgotischer Flügelaltar mit aus Holz geschnitzten
vergoldeten Figuren befand sich neben dem Turmeingang.
Ein hervorragendes Kunstwerk ist das
von Meister Bernhuser 1387 aus Bronze gegossene Taufbecken. Den von
liegenden Löwen umgebenen Sockel schmücken zwischen gotischen Arkaden
die Gestalten von acht Aposteln. Das Becken selbst zeigt in knapper,
eindringlicher Darstellung acht Szenen aus dem Marienleben.

Bild Nr. 4: Nikolaikirche. Taufbecken von 1387. Der Erzguß
spielte im Ordenslande hauptsächlich für die Herstellung von
Feuerbüchsen eine Rolle. Wegen dieser Büchsen war Preußen damals in
ganz Europa berühmt.
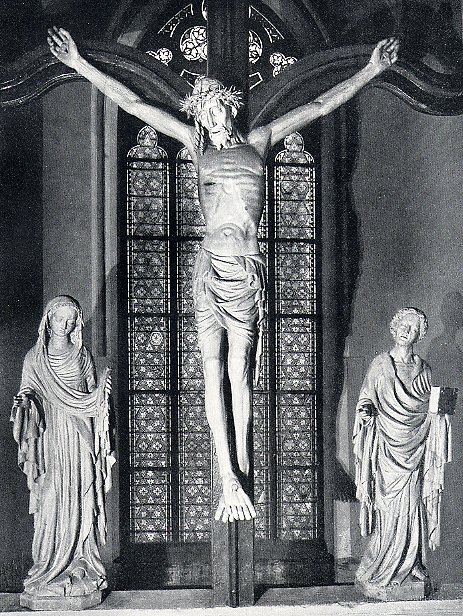
Bild
Nr. 5: Kreuzigungsgruppe in der Nikolaikirche mit Maria und Johannes
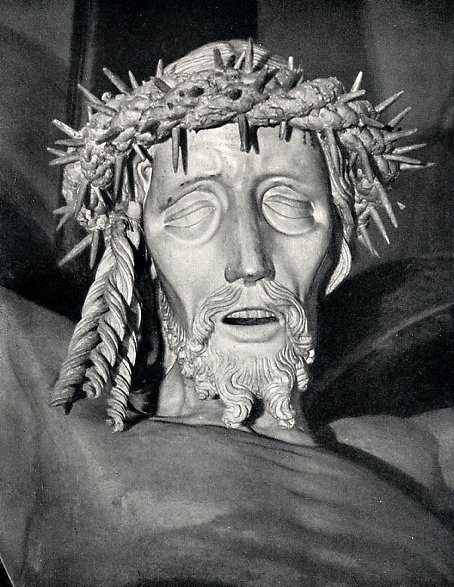
Bild Nr. 6: Christuskopf - Detail aus der Kreuzigungsgruppe
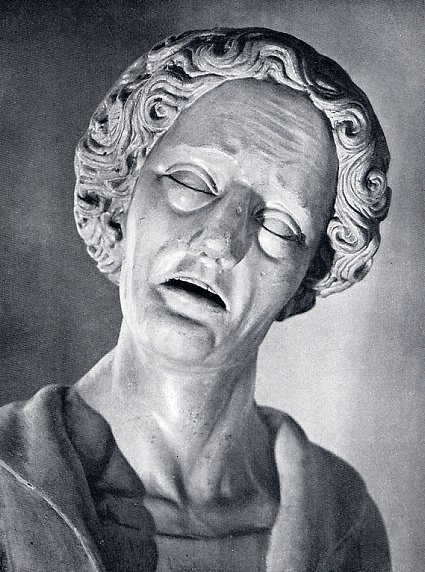
Bild
Nr. 7: Johannes der Täufer - Detail aus der Kreuzigungsgruppe
In den Jahren 1573 bis 1617 war die St.
Nikolaikirche die Hauptkirche der Evangelischen, wurde aber nach
langwierigen Prozessen von den Polen, die damals die Oberherren von
Elbing waren, den Katholischen zugesprochen. Zweimal ist sie noch im
Besitz der Evangelischen gewesen, nämlich zur Zeit der schwedischen
Besatzung unter Gustav Adolf (1626-1632) und zur Zeit des
Schwedisch-Polnischen Krieges (1655-1660). Seit dem Frieden von Oliva
(1660) ist sie dauernd die Hauptkirche der Katholischen geblieben.
Im
Januar 1945 wurde durch die Kriegseinwirkung die Kirche erneut schwerstens beschädigt und brannte am 2. Februar zusammen mit der
Altstadt völlig aus. Übrig blieben nur die Stahlkonstruktion des
Turmes und die Seitenmauern. Glücklicherweise konnte fast die ganze
gotische Innenausstattung rechtzeitig in verschiedene Dorfkirchen
ausgelagert und somit gerettet werden.
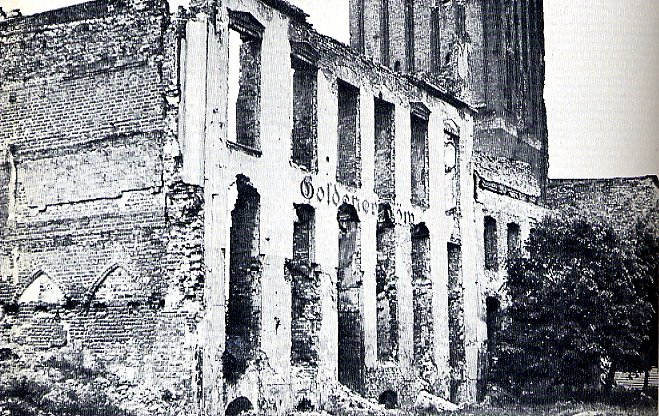
Bild Nr. 8: Die Brückstraße: links sieht man das ausgebrannte Gasthaus
"Zum Goldenen Löwen" und rechts einen Teil des zerstörten
Kirchturms der Nikolaikirche. (siehe Bild Nr. 1)

Bild Nr. 9: Das ist von der Nikolaikirche und den schönen Patrizierhäusern
am Elbing-Fluß übrig geblieben.
Der
Wiederaufbau erfolgte 1948-55, wobei die ursprüngliche Außenform
(dreiteiliges Satteldach) wiederhergestellt und der Turm nach den
Bauplänen von 1598-1603 rekonstruiert wurde. Im Innenraum wurde
versucht, den Zustand, wie er vor 1777 war, herzustellen. Aus statischen
Gründen konnte das Stern- und Kreuzgewölbe (wie bis 1777 vorhanden)
nicht mehr errichtet werden. So liegt heute eine einfache Betondecke auf
den Pfeilern . Hinter dem Hochaltartisch erfolgte die Freilegung von 3
Spitzbögen (Zustand 1260-1330).
Die Turmspitze wurde ebenfalls wieder hergestellt und 1990 durch einen neuen
Anstrich vor den Einflüssen der Witterung geschützt. In der Kirche
fanden Altäre und Sakralgegenstände aus verschiedenen Elbinger Kirchen
(u. a. St. Marien und Drei Könige) einen neuen Platz,
ebenso der Altar der Cadiner Kirche. Von 1968-80 wurden in den Fenstern
neue Maßwerke und Rosetten aus Sandstein angebracht und mehrere Fenster
mit farbigen Motiven ausgestattet. St. Nikolai ist seit 1992
Kathedralkirche des neuerrichteten Bistums Elbing.
Grundmann,
Friedrich: Elbinger Heimatbuch, Geschichte und Geschichten vom
Elbingfluß. Überarbeitet und ergänzt v. Hans-Jürgen Schuch, Elbinger Hefte Nr. 45,
Münster: Truso-Verlag 1999, 100. Abb., 160 Seiten, Text S. 20-23.
Schuch, Hans-Jürgen: Elbing wie es heute ist, Reiseeindrücke
in Wort und Bild aus der alten Hansestadt und ihrer Umgebung. Elbinger
Hefte Nr. 41, Münster: Truso-Verlag 1991 zahlr. Abb., 144 Seiten, Text
S. 18.
Wassermann, Charles: Unter polnischer Verwaltung, Tagebuch
1957, Gütersloh, Bertelsmann - Lesering 19057, mit 163
Originalaufnahmen des Verfassers, 304 Seiten, 2 Abb. S. 110.
Elbinger
Nachrichten: Münster: April 2000, S. 8+9.
Clasen, Karl Heinz:
Elbing. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle, hrsgg. von Burkhard
Meier, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1931, 37 Bildtafeln und 15 Seiten
Text, Abb. Tafel 24, 27-29, Text S. 6, 14.
Carstenn, Edward: Geschichte der
Hansestadt Elbing. Elbing: Verlag von Léon Saunier's Buchhandlung 1937,
50 Tafeln, 539 Seiten, Abb. Tafel 40.
Steffen, Alfons:
"Geschichte der St. Nikolai-Kirche" in den Elbinger Briefen
Nr. 32, hrsgg. von Berhard Heister, Sept. 1981, mehrere Abb., 60 Seiten,
Text S. 10.
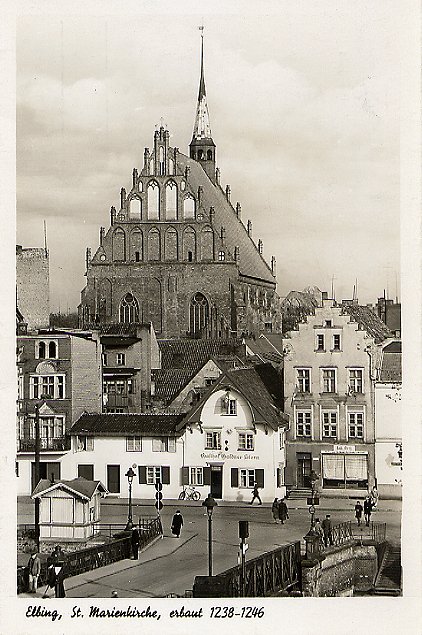
Bild Nr. 10: Blick von der Hohen Brücke auf den Westgiebel der St. Marienkirche,
(erbaut 1238-1246). Das weiße Gebäude ist das Gasthaus "Goldener
Stern."
Die St. Marienkirche ist von dem Mönchsorden
der Dominikaner, einem Prediger- und Bettelorden, gegründet worden. Diesem erteilte
der Hochmeister Heinrich von Hohenlohe am 24. Mai 1246 die Erlaubnis,
nahe bei der nordwestlichen Stadtmauer Klostergebäude und, der
Klosterregel entsprechend, eine Kirche ohne Turm zu bauen. Die
Kirche des Bettelordens durfte nur einen Dachreiter besitzen, aber
keinen Turm, weil dieser bei den Dominikanern als Hoffahrt verpönt
war.
Die
Dominikaner "wirkten mächtig durch Werk und Wort im
Preußenlande", waren aber arme Bettelmönche. Sie mußten also
Kloster und Kirche von den Erträgnissen der milden Gaben erbauen, die
sie eingesammelt hatten. So entstand die Kirche, an der die Handwerker
in ihrer freien Zeit umsonst zu arbeiten pflegten, nur nach und
nach. Sie wurde der Mutter Gottes geweiht und daher Kirche zu St.
Marien genannt.
Die Schiffer verrichteten dort ihre Gebete,
bevor sie auf große Fahrt gingen. Im Kreuzgang und im Klosterhofe ruhen
die Kaufleute aus London, neben denjenigen von Elbings Artushof. St.
Marien war später die evangelische Hauptkirche Elbings.
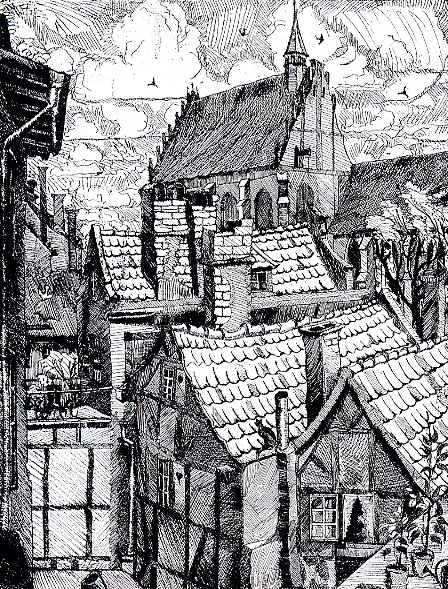
Bild Nr. 11: Hinterhöfe in der Wilhelmstraße, Rückseite der
Kürschnerstraße, dahinter St. Marien, die evangelische Haupt- und
Garnisonskirche. Radierung von Wilhelm Noack, Elbing 1922.
Der hohe, schlanke Säulenbau, der die
gewölbte Decke trägt, sowie die hohen spitzbogigen Fenster und das
schöne dreiteilige Altarbild machen die Marienkirche zu einem der
schönsten Gotteshäuser Elbings. Als einstige Klosterkirche besteht sie
aus dem nach Osten liegenden Chor und dem Langschiff. Chor und Kreuzgang
haben Kreuzgewölbe, die Langkirche ein schönes Netzgewölbe.
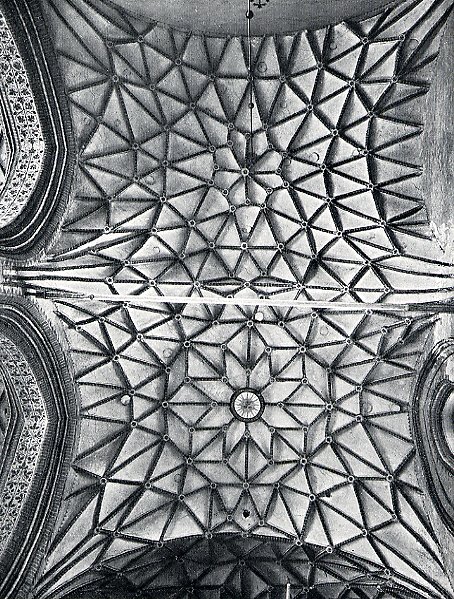
Bild
Nr. 12: Das Netzgewölbe in der Kirche St. Marien. Diese Am Anfang des
16. Jahrh. entstandenen Netzgewölbe bedeuten die Endstufe einer reichen
Gewölbeentwicklung im Ordenslande.
Der Hochaltar trennt die Langkirche vom Chor. Es ist
ein schöner, spätgotischer Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert mit
aus Holz geschnitzten, vergoldeten Figuren.
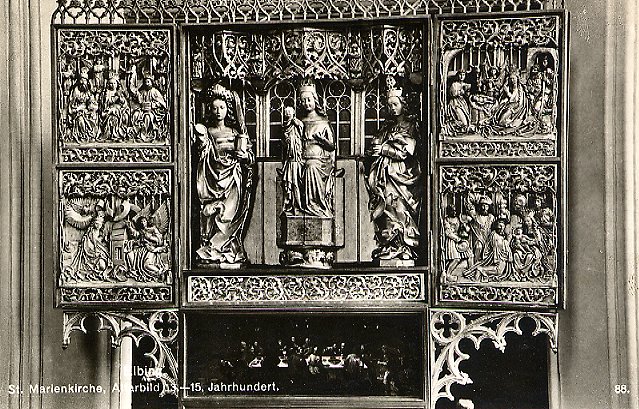
Bild Nr. 13: Altarbild in der Marienkirche aus dem 15. Jahrhundert
Im mittleren Teil erblickt man Maria mit dem
Christuskind, zur Rechten Maria Magdalena, zur Linken Barbara. Die
Figur der Maria ist zu öffnen.
Hier handelt es sich um eines der
bedeutendsten Schnitzwerke nicht nur der Ordenskunst, sondern der ganzen
deutschen Plastik.
Im Innern der Maria zeigt sich, geschnitzt,
Gottvater, der Christus am Kreuz vor sich auf dem Schoß hält, und auf
den geöffneten Türen des Altars sind Ordensgeistliche männlichen und
weiblichen Geschlechts, zwei Ritter des deutschen Ordens, der Papst und
drei Kardinäle gemalt.

Bild Nr. 14: Schreinmadonna (Schutzmantelmadonna) in der Marienkirche mit geöffneten Flügeln.
Im Innern der Gnadenstuhl.
Auf dem rechten Flügel
sieht man Maria in der Herrlichkeit zwischen Gottvater und Christus, von
Engeln gekrönt, unten die Verkündigung Mariä, auf dem linken Flügel
aber die Anbetung der Hirten, unten die Anbetung der Heiligen Drei
Könige.
An kunstvollen Schnitzereien befinden sich an der
Ostseite des Chors ein kleiner, gotischer Flügelaltar mit vergoldeten
Schnitzereien, in der Sakristei ein Altaraufsatz. Auch die 1598
verfertigte Kanzel zeigt schön gearbeitete Holzschnitzereien im Stil
der Spätrenaissance.
An die Marienkirche schließt sich
nach Westen der altertümliche Klosterhof, nach Norden ein Garten, der
früher als Begräbnisplatz diente, an.

Bild
Nr. 15: Blick von der Kürschnerstraße in den Klosterhof der Dominikaner.

Bild Nr. 16: Die Marienkirche mit dem Klosterhof
Der
vertraute gotische Backsteinbau ist nach dem Kriege wieder renoviert
worden. Das Dachreiterchen, das die Glocken barg, ist nicht mehr
vorhanden. Der große leere Innenraum birgt die "Galerie EL",
eine moderne Kunstgalerie und auf dem Kirchenboden befinden sich die
Ateliers verschiedener Künstler.
Clasen, Karl Heinz:
Elbing. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle, hrsgg. von Burkhard
Meier, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1931, 37 Bildtafeln und 15 Seiten
Text, Abb. Tafel 22, 25, Text S. 6, 13.
Schuch, Hans-Jürgen: Elbing. Aus 750 Jahren Geschichte der
Ordens-, Hanse- und Industriestadt. Berlin/Bonn: Westkreuzverlag 1989.
Viele Abb., 168 Seiten, Abb.+ Text S. 27.
Grundmann,
Friedrich: Elbinger Heimatbuch, Geschichte und Geschichten vom
Elbingfluß. Überarbeitet und ergänzt v. Hans-Jürgen Schuch, Elbinger Hefte Nr. 45,
Münster: Truso-Verlag 1999, 100. Abb., 160 Seiten, Text S. 30, 33.
Heister, Bernhard: "Elbinger Häuser " im
Westpreußen-Jahrbuch 1955, hrsgg. von der Landsmannschaft Westpreußen,
Leer: Verlag Rautenberg & Möckel, mehrere Abb., 161 Seiten, Text S.
68.
Heister, Bernhard: "Elbing-Reise 1975" in den Elbinger
Briefen Nr. 27, Sept. 1976, mehrere Abb., 60 Seiten, S. 46.
Schuch, Hans-Jürgen:
Elbing wie es heute ist. Elbinger Hefte Nr. 41. Münster: Truso-Verlag
1991, mehrere Abb., 144 Seiten. Text S. 38.
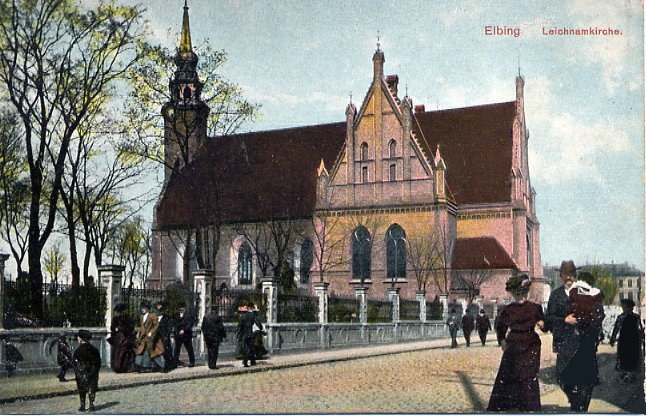
Bild Nr. 17: Die Kirche "Zum Heiligen Leichnam" in der
Heilig-Leichnamstraße (14.6.1911)
Als die Altstadt von
Elbing 1237 gegründet wurde und noch 60 Jahre danach war die Gegend der
Heilig-Leichnamstraße ganz mit Wald bedeckt. In diesem Wald bauten die
Bewohner ein Hospital für Aussätzige und weihten es St. Georg. Dieses
St. Georg - Hospital erhielt auch eine Kapelle.
Der Sage nach soll
sie von einigen holländischen Seefahrern zum Dank für die Rettung aus
Seenot, erbaut worden sein.
Im Jahr 1400 brannte die St.
Georg-Kapelle ab. Als man danach den Schutt forträumte, fand man die
Hostie (den heiligen Leichnam) unversehrt unter den Trümmern liegen,
wogegen das Säckchen, darin der heilige Leichnam gelegen hatte,
versengt war. Darauf strömten große Scharen von Wallfahrern herbei, um
das Wunder zu schauen. Die Spenden flossen reichlich, so daß sich der
Ordensbruder Helwing Schwan dazu entschloß, an dieser Stelle eine
Kirche zu erbauen, die er "Zum Heiligen Leichnam" benannte.
Das war im Jahre 1405.

Bild Nr. 18: Das Innere der Heilig-Leichnamkirche mit dem berühmten
Deckengewölbe.
Das Innere der Heilig-Leichnamkirche
enthielt das einzige in Deutschland ausgeführte Holzgewölbe mit
Hängepfosten, dessen Vorbild in England zu suchen ist, und manche
wertvolle Skulpturen und Malereien: den Barockaltar mit seinen wie
lebend gemalten Bildnissen und seine geschnitzten Figuren, eine
Madonnenstatue und eine Reihe biblischer Gemälde. Altar und Kanzel sind
im Jahre 1646 errichtet worden. Die Kirche ist 1896 einer gründlichen
Ausbesserung unterzogen und durch einen Anbau erweitert worden.

Bild Nr. 19: Die
Heilig-Leichnamkirche mit Gemeindehaus
Kirche
und Gemeindehaus wurden 1945 stark beschädigt. Die Kirche wurde später
(wesentlich kleiner) und mit einer Zwischendecke verändert wieder
aufgebaut.
Etwa ab 1970 wurde sie von der
Handwerkergenossenschaft als Klub- und Kulturhaus mit Café genutzt. Im
Dezember 1981 kaufte die katholische Kirchengemeinde das ehemalige
evangelische Gotteshaus, um darin vor allem Kindern Religionsunterricht
zu erteilen.
Grundmann, Friedrich: Elbinger Heimatbuch,
Geschichte und Geschichten vom Elbingfluß, überarbeitet und ergänzt
von Hans-Jürgen Schuch,
Elbinger Hefte Nr. 45, Münster: Truso-Verlag 1999, 100 Abb., 160
Seiten,
Schuch, Hans-Jürgen: Elbing wie es heute ist, Reiseeindrücke
in Wort und Bild aus der alten Hansestadt und ihrer Umgebung. Elbinger
Hefte Nr. 41, Münster: Truso-Verlag 1991 zahlr. Abb., 144 Seiten, Text
Lockemann, Theodor: Elbing - Deutschlands Städtebau. Hrsgg. vom
Magistrat von Elbing, mit zahlr. Abb., 200 Seiten, Berlin-Halensee:
DARI-Verlag 1926.
Pudor, Carl: Elbing und seine Umgebung, hrsgg. vom Verein zur Hebung des
Fremdenverkehrs für Elbing und Umgebung, Wernichs Buchdruckerei 1910,
Reprint Leer: Verlag Gerhard Rautenberg 1989, S. 45.
Clasen, Karl
Heinz: Elbing. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle, hrsgg. von
Burkhard Meier, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1931, 37 Bildtafeln und 15
Seiten Text, Abb. Tafel 23.
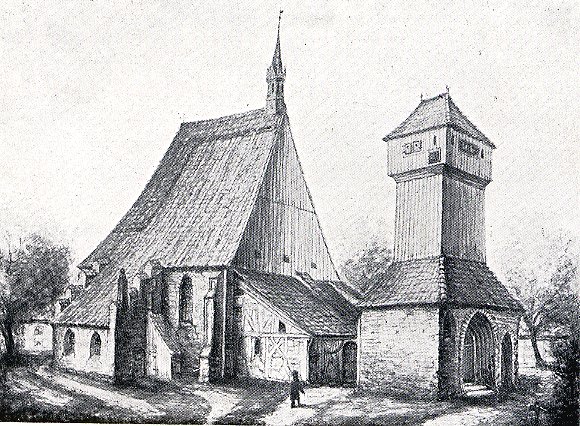
Bild Nr. 20: Neustädtische Pfarrkirche zu den Heiligen Drei
Königen (erbaut um 1341)
Die alte Pfarrkirche der mittelalterlichen Neustadt, zu Heiligen Drei Königen, die mit mehreren
Anbauten und einem gesondert stehenden Glockenturm ein sehr malerisches
Bauwerk war, ist leider 1881 wegen Baufälligkeit abgebrochen und neu
erbaut worden.
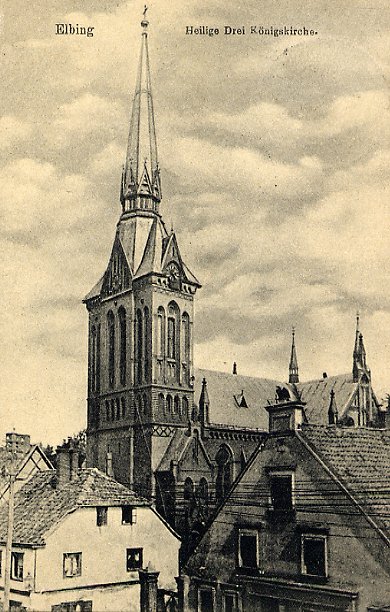
Bild Nr. 21: Die Heilige Drei Königskirche
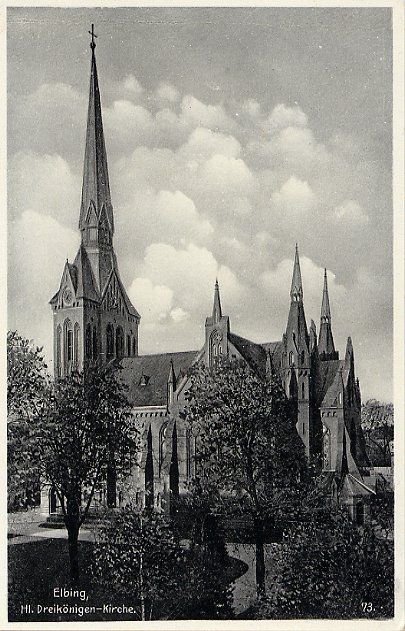
Bild Nr. 22: Die Heilige Drei Königskirche aus einem anderen
Blickwinkel
Die neue Kirche wurde 1885
eingeweiht. Der alte
Hochaltar wurde in den Neubau überführt; d.h. der Mittelschrein und
die beiden Innenflügel sind erhalten, die Außenflügel fehlen. Den
Mittelschrein und die vier Darstellungen der Innenseiten der Flügel
bilden gemalte und reich vergoldete Holzschnitzereien. Alle
Darstellungen sind gerade abgeschlossen durch reiches Rankenwerk.
Dargestellt
ist im Mittelschrein die Anbetung der Heiligen Drei Könige, auf den
Flügeln links die Verkündigung und die Beschneidung, in der Predella
die Hl. Dorothea, die Hl. Barbara, die Hl. Katharina und die Hl.
Margarete. Die Außenseiten der Flügel sind gemalt.
Die sehr
schwungvollen Schnitzereien von technisch hohem Können stammen aus dem
Anfang des 16. Jahrhunderts. Der sonst bisher nicht weiter nachgewiesene
Künstler hat seinen Namen "Schofstein" (Schofstain) auf den
Ärmelrand des knienden Königs Balthasar eingeschnitzt.
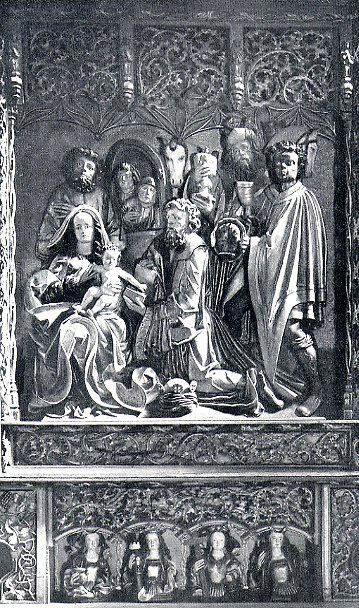
Bild Nr. 23: Mittelschrein des Hochaltars der Kirche zu den Heiligen Drei
Königen. Es handelt sich um ein Hauptwerk nordostdeutscher Schnitzkunst
jener Zeit.
Ein sehr schöner Schmuck der Kirche war
außerdem das von Kaiser Wilhelm I. geschenkte Ölgemälde von
Professor Schrader "Die Anbetung der Könige" mit lebensgroßen
Figuren. 1945 wurde die Heilige Drei Königskirche
vollständig zerstört.
Clasen, Karl Heinz: Elbing. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle,
hrsgg. von Burkhard Meier, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1931, 37
Bildtafeln und 15 Seiten Text, Abb. Tafel 31, Text S. 14.
Kownatzki, Hermann: Brückenkopf Elbing,
Preußenführer, hrsgg. von E. Weise, H. Kownatzki, Elbing:
Preußenverlag 1936, mehrere Abb., 120 Seiten, Text S. 61+62. Hermann
Kownatzki war Stadtarchivar von Elbing.
Krüger,Emil: Elbing - Eine
Kulturkunde auf heimatlicher Grundlage. Elbing: Léon Saunier's
Buchhandlung, Verlag 1930, mehrere Abb., 224 Seiten, Abb. S. 35.
Pudor, Carl: Elbing und seine Umgebung, hrsgg. vom Verein zur Hebung des
Fremdenverkehrs für Elbing und Umgebung, Wernichs Buchdruckerei 1910,
Reprint Leer: Verlag Gerhard Rautenberg 1989, S. 45, 46.
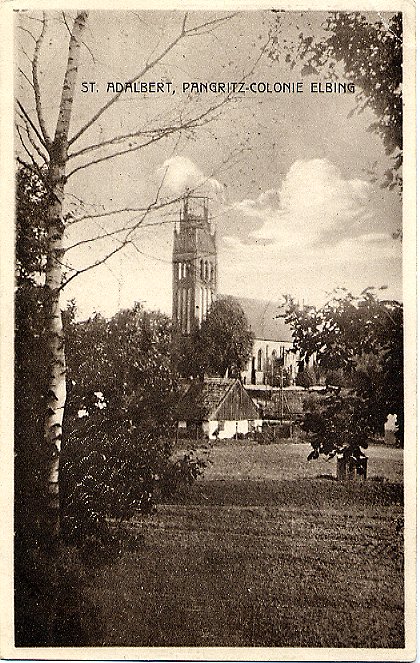
Bild
Nr. 24: Die St. Adalbertkirche auf Pangritz Kolonie
Als
die St. Adalbertkirche auf Pangritz Kolonie in der Adalbertkirchstraße
am 17. März 1901 eingeweiht wurde, gehörte dieses Gebiet zum Elbinger
Territorium und damit zum Landkreis Elbing. Nach der Eingemeindung der
Pangritz Kolonie in die Stadt Elbing im Jahre 1913 war sie nach der St.
Nikolaikirche die 2. katholische Kirche der Stadt Elbing.
Die Pfarrer
waren ab 1906 Hugo Ganswind und ab 1936 Aloyas Schmauch, ein Bruder
des bekannten Kopernikusforschers Professor Dr. Hans Schmauch.

Bild Nr. 25: Die St. Adalbertkirche aus der Nähe. (1.8.1934)
Die
im Ordensstil erbaute und dem Heiligen Adalbert geweihte Kirche wurde
1945 nicht zerstört. Sie war vielen Deutschen 1945 ein Ort der Erbauung
in sehr schwerer Zeit, um die sich nach Kräften drei Kaplane sorgten.
An der Kirche besteht noch der alte Friedhof, auf dem auch das Grab des
Elbinger Zigarren- und Tabakfabrikanten Albert Lange erhalten
blieb.
Die St. Adalbertkirche wurde nach dem Bischof und
Märtyrer "Adalbert von Prag" benannt. Adalbert, der mit
Taufnamen "Wojtech" hieß, wurde 956 in Libice (CSFR) geboren.
Im Alter von 27 Jahren wurde er 983 2. Bischof von Prag. Im
Jahre 989 legte er sein Bischofsamt nieder und trat in Rom in das
Benediktinerkloster "St. Bonifatius und Alexius" ein. Nach
weiteren Stationen in Prag und Rom, missionierte er nach der
Ermordung seiner Familie 996, mit tatkräftiger Unterstützung durch den
Polenherzog Boleslaw, einige Monate in Ostpreußen.
Aber schon am
23. April 997 wurde der Kirchenmann bei Tenkitten im Samland von
Glaubensgegnern erschlagen. Herzog Boleslaw ließ Adalbert von Prag im
Dom von Gnesen, der ihm geweiht wurde, im heutigen Polen beisetzen.
Bereits 999 wurde der Bischof von Papst Silvester II. heiliggesprochen.
Elbinger
Nachrichten, Münster: Dezember 2001, Text S. 1+2.
Schaube, Vera/
Schindler, Hanns Michael: Heilige und Namenspatrone im Jahreslauf,
Pattloch Verlag 1992, zahlr. Abb., 702 Seiten, Text S. 172+173.
dtv-Lexikon
Band 1, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1971, mehrere Abb., 319
Seiten, Text S. 31.
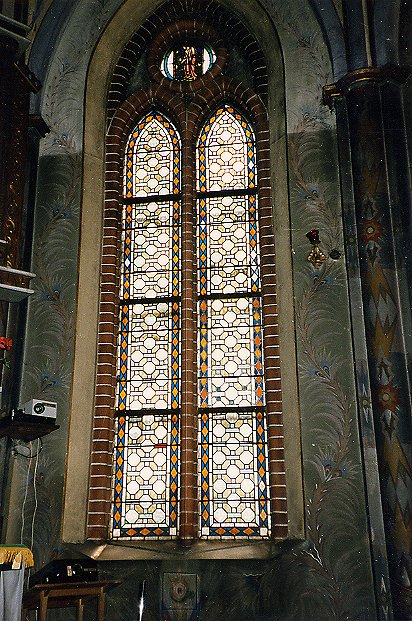
Bild
Nr. 26: Kirchenfenster in der Pauluskirche, Elbing 1985
Etwas
älter als die St. Adalbertkirche ist die 1895 eingeweihte evangelische St.
Pauluskirche in der Lindenstraße, die auch zur Pangritz Kolonie gehörte.
1896 wurde sie aus Heilig-Leichnam ausgepfarrt. Hier entstand zusammen
mit Lärchwalde eine neue selbständige evangelische Kirchengemeinde.
Der Kirchenbauer und Hilfsprediger Wilhelm Daniel Böttcher ging 1897
als Pfarrer nach Schlochau. Sein Nachfolger Hermann Ferdinand Ludwig
Knopf wurde 1899 Erster ordentlicher Pfarrer der neuen Kirchengemeinde,
bis ihn 1936 Franz Jeroschewitz ablöste, der als Gefangener in Sibirien
verstarb.
Die St. Pauluskirche hat den
Zweiten Weltkrieg ebenfalls überstanden. Beide Kirchen werden jetzt von der
Katholischen Kirche genutzt, die nördlich von St. Adalbert zusätzlich
eine neue Kirche baute.
Elbinger Nachrichten, Münster:
Dezember 2001, S. 1+2.
Schuch, Hans-Jürgen: Elbing. Aus 750 Jahren
Geschichte der Ordens-, Handels- und Industriestadt. Berlin/Bonn:
Westkreuz-Verlag 1989, mehrere Abb., 168 Seiten, Text S. 79.
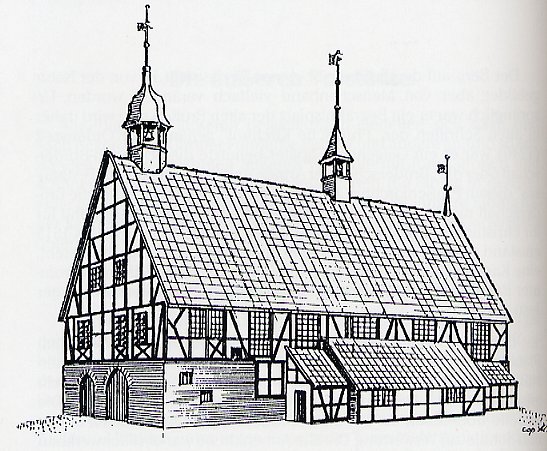
Bild
Nr. 27: Die "Kirche St. Annae auf dem Berge". Zeichnung von
Gerhard Salemke.
Von 1611 bis 1621 baute die
St.-Annen-Brüderschaft auf dem Platz, auf dem später die neue Kirche
stand, mit Unterstützung des Rates der Stadt Elbing und wohlhabender
Privatleute ein großes Gotteshaus, als Ersatz für die abgebrochene
Jakobskirche. Die alte Annenkirche war ein Fachwerkbau und wurde schon
damals "die Kirche St. Annae auf dem Berge" oder die "Bergsche
Kirche" genannt.
Kaum war das Kirchlein fertig, so drohte ihm schon
der Untergang. Als die Schweden 1626 unter Gustav Adolf in Elbing
einzogen, bauten sie die schon vorhandene Verschanzung um die Kirche
stärker aus und besetzten sie mit Geschützen. Dabei war ihnen die
Kirche im Wege. Der Schwedengeneral wollte sie deshalb abbrechen lassen,
aber Gustav Adolf sagte: "Die Kirche soll Er stehen lassen; ich bin
nicht gekommen, Kirchen zu zerstören, sondern gedenke, noch neue zu
bauen." So hat sie nahezu 300 Jahre gestanden, bis sie 1899 durch
den prächtigen gotischen Neubau ersetzt
wurde.
Grundmann,
Friedrich: Elbinger Heimatbuch, Geschichte und Geschichten vom
Elbingfluß. Überarbeitet und ergänzt v. Hans-Jürgen Schuch, Elbinger Hefte Nr. 45,
Münster: Truso-Verlag 1999, 100. Abb., 160 Seiten, Abb. S. 58, Text S.
57.
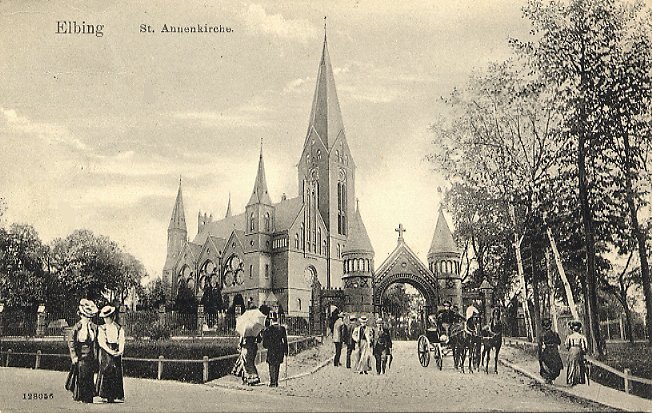
Bild
Nr. 28: Die neue St.
Annenkirche. Diese Ansichtskarte wurde nach New Jersey, USA, geschickt.
Die neue St. Annenkirche wurde in den Jahren
1899-1901 nach den Plänen und unter der Oberleitung des berühmten
Kirchenbaumeisters Professor Otzen errichtet. Das Innere der neuen Kirche machte durch die
einfache, aber würdige Ausstattung in Form und Farbe einen
herzerhebenden Eindruck.
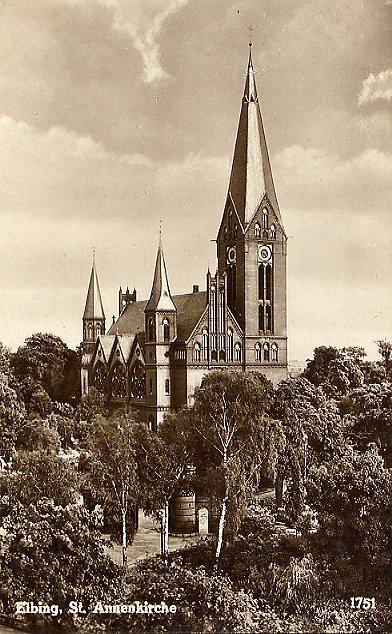
Bild Nr. 29: St. Annenkirche
Im Jahr 1921 konnte die St. Annen -
Kirchengemeinde das Fest des 300jährigen Bestehens feiern. 1945 wurde
diese schöne Kirche beschossen und anschließend gesprengt.
Lediglich die Leichenhalle blieb erhalten. Sie ist heute eine
kleine Kapelle.
Krüger, Emil:
Elbing. Eine Kulturkunde auf heimatlicher Grundlage. Elbing: Léon
Saunier's Buchhandlung, Verlag 1930, viele Abb., 224 Seiten, Text S.
205.
|