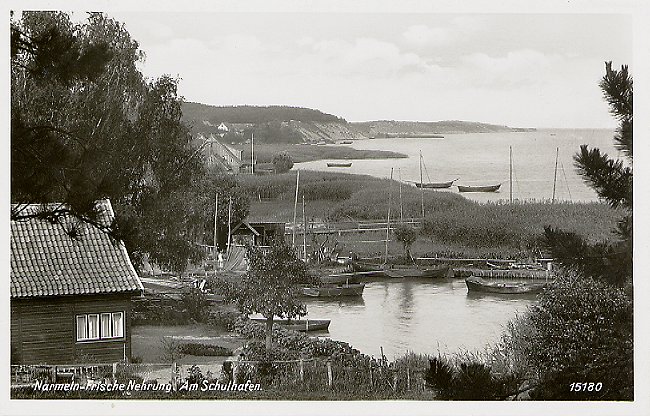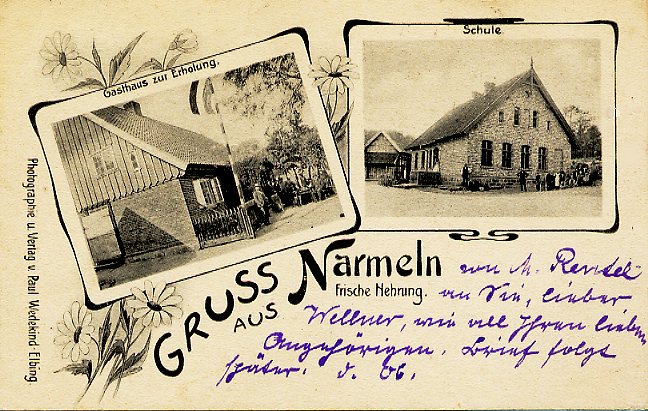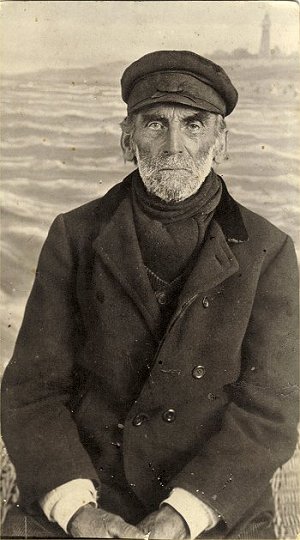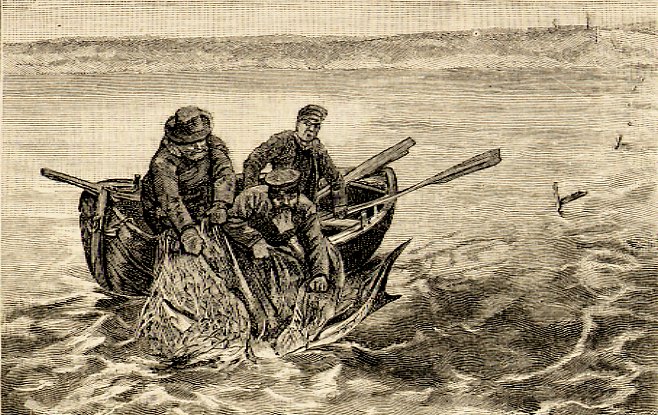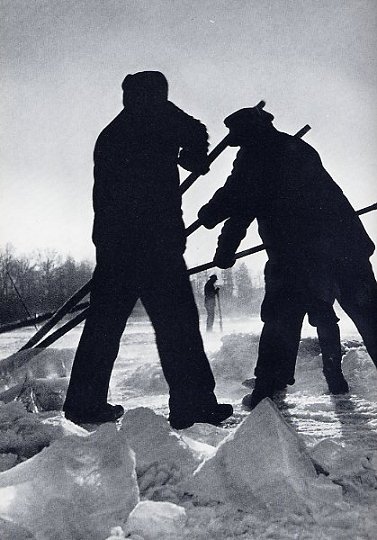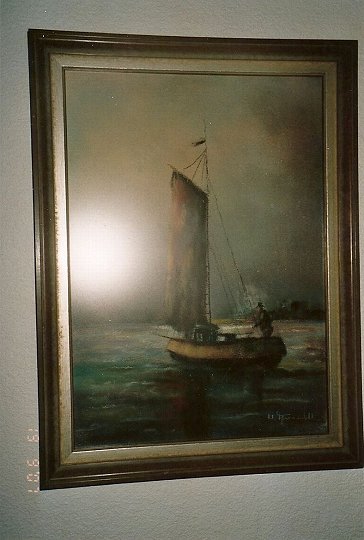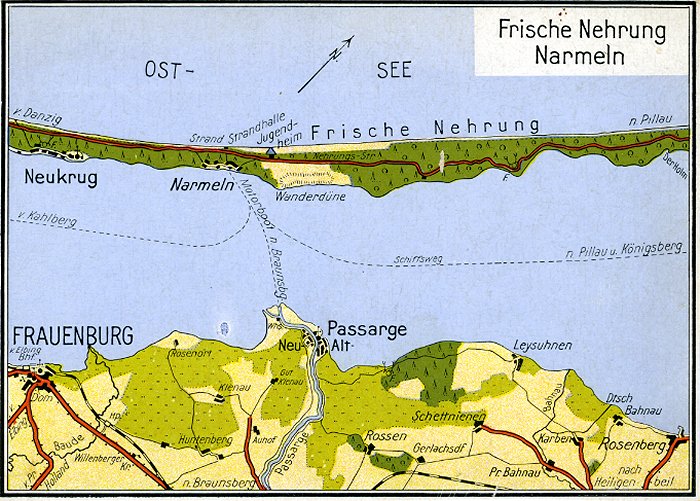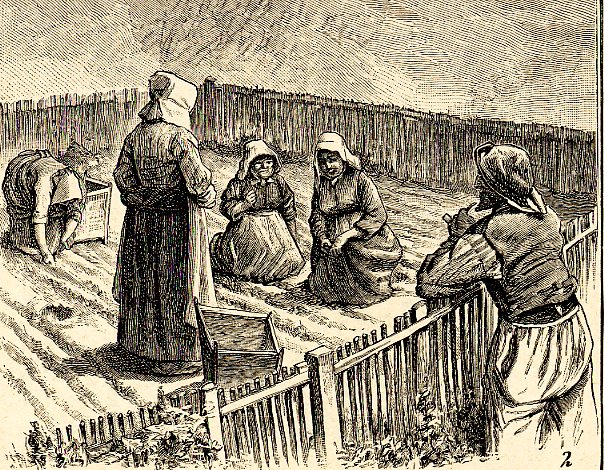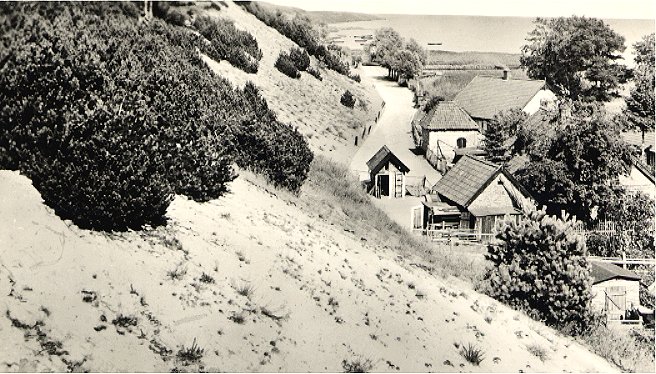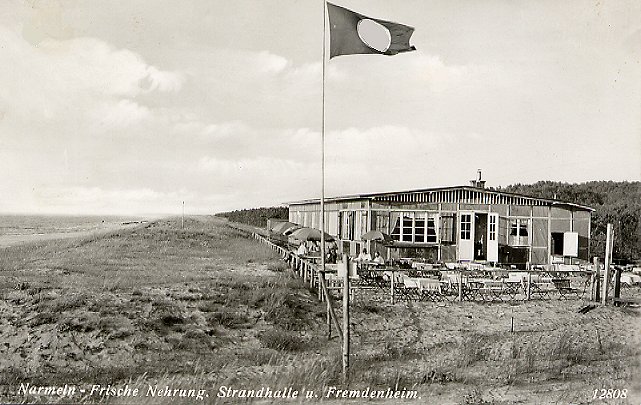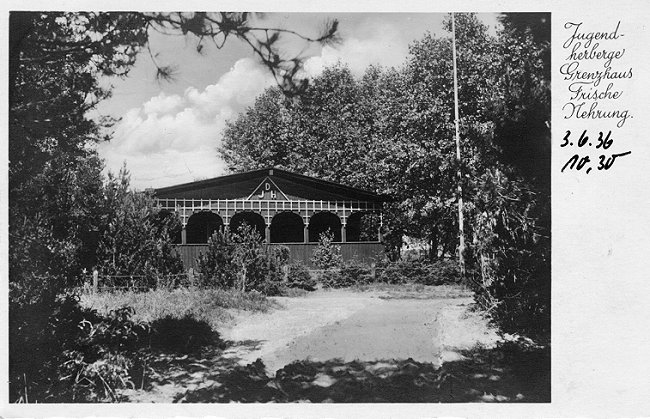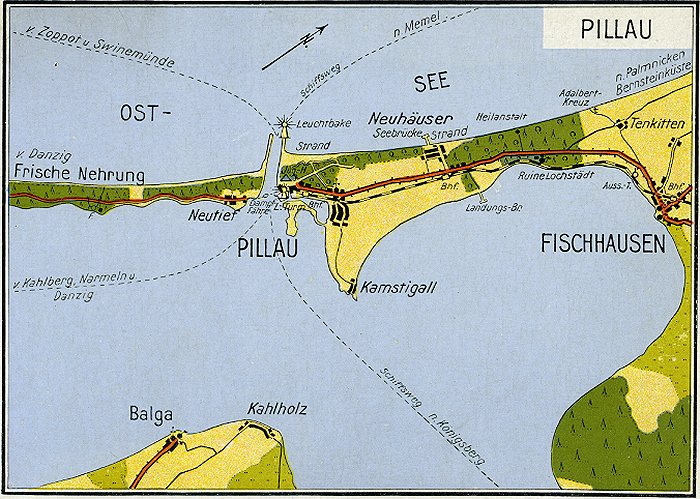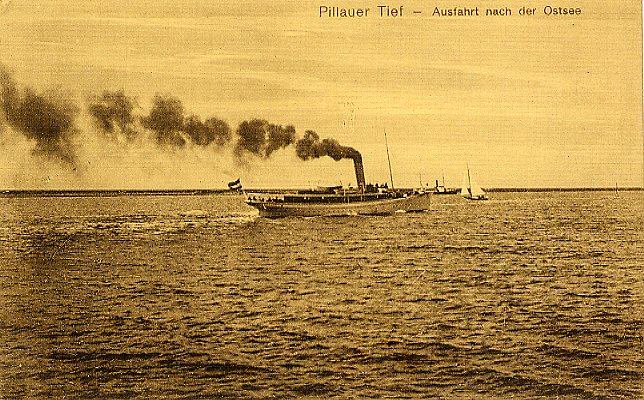in historischen Ansichtskarten
Frische Nehrung, Narmeln und Neutief - Teil
9
Mierzeja Wislana, Polski, Kosa -
9
von Christa Mühleisen
Die Geschichte von
Narmeln
Am 12. Dezember 1489 stellte der Rat der Stadt Danzig eine
Handfeste für den Krug in Narmeln aus, das in der Urkunde "Ermelen"
genannt wird. Der Krüger hieß Hans Voyte. Damals muss sich also die
Nehrung bis zum heutigen Grenzhause schon im tatsächlichen Besitz
der Stadt Danzig befunden haben.
Als Landmaß wurden in dieser
Handfeste nicht die deutsche Hufe, sondern der altpreußische Haken (= 2/3
Hufe) verwandt, ein Zeichen, dafür, dass damals noch Altpreußen in
diesem entlegenen Landstrich wohnten. Andererseits wurden die Krüge immer
zu kulmischem Recht, d. h. nach deutschem Recht verliehen. Das ist ein
Beweis dafür, dass die Krüger auf der Nehrung deutschen Stammes waren.
Sie wurden auch während der Ordenszeit der Herrschaft zu
persönlichem Dienst verpflichtet.
Das Dorf wurde bis ins 17.
Jahrhundert nur "Narmeln" genannt. Dann kam der Name
"Polski " für Narmeln auf. Das hat aber nichts mit Polen
zu tun, vielmehr lebte um 1660 ein Besitzer Polski in dem jetzigen Narmeln,
dessen Name auf das Dorf übertragen worden ist. Vielleicht ist er damals
der größte Besitzer in Narmeln gewesen. Die Sitte, dass Ortschaften nach
ihrem Besitzer benannt wurden, findet man ja häufig.
Unter Danzigs
Herrschaft blieb Narmeln, wie dieser ganze Nehrungsteil, bis 1793. Damals
kam er an Preußen, um aber von 1807-14 wieder zum Freistaat Danzig zu
gehören. Danach gehörte er wieder zu Preußen. 1880 wurde eine
Telegraphenleitung, die Pillau mit Kahlberg verband, gelegt, und in
Narmeln ein Fernsprechamt eingerichtet. 1898 brannten in Narmeln 6
Wohnhäuser ab.
1906 erhielt Narmeln auf Veranlassung von Kaiserin
Auguste Victoria, die 1905 das Dorf von Cadinen aus besucht hatte, einen
Hafen, der aus einer 2 m tiefen Fahrrinne und einem 2,5 m tiefen Bassin
bestand. An der Nordseite des Hafens wurde eine 50 m lange Mole gebaut.
Der Hafen ist während der Kriegszeit (1914-1918) aber wieder versandet.
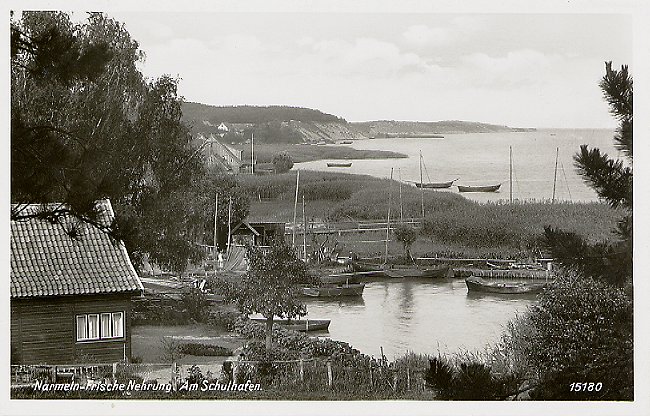
1.
Am Schulhafen in Narmeln
1908 wurde, um die schlechten Wegeverhältnisse auf der Nehrung
wenigstens zeitweise zu beseitigen, seitens der Festungsbauverwaltung
Pillau vom Grenzhaus bei Narmeln bis Vöglers bei Neukrug ein 3 m breiter
und 20 cm tiefer Kiesweg aufgeschüttet. Kurz vor dem 1. Weltkrieg wurde
dann die Chaussee gebaut.
1920
kommt Narmeln nach der Schaffung des Freistaates Danzig zum Landkreis
Elbing. Damals hat Narmeln 274 Einwohner und eine Landfläche des Ortes
von 6 ha.
1924 tritt erstmals die Haffkrankheit bei Narmeler Fischern
auf.
1927 wird die Jugendherberge Grenzhaus bei Narmeln erbaut.
1932
kommt es zum zweiten Auftreten der Haffkrankheit bei den Narmeler
Fischern.
1933
wird die Strandhalle erbaut.
1937 sind in Narmeln 86 offene
Fischerfahrzeuge beheimatet.
1939 werden bei der letzten Volkszählung
295 Einwohner in 75 Haushaltungen gezählt.
1945: am 30. April wird
Narmeln von den Russen erobert.
Kerstan, Lic. Dr. E. G.: Die Geschichte des Landkreises Elbing. Elbing:
Verlag der Elbinger Altertumsgesellschaft 1925, 473 Seiten, S. 270, 271.
Mielcarczyk, Georg: Narmeln - Neukrug - Vöglers - Ein Kirchspiel auf der
Frischen Nehrung, Bremerhaven: Truso-Verl.1981, einige Abb., 101 Seiten,
Text S. 94+95 (Chronik v. Narmeln)
Die Schulen in Narmeln und Neukrug
Bis 1878 wurden die Kinder von Narmeln nach Neukrug eingeschult. Das
älteste Schulhaus befand sich in Alt-Neukrug, ungefähr auf der
Hälfte des Weges von Narmeln nach Neukrug auf der Haffseite. Dort wo
die Buche steht, die im Volksmund "die alte Schule" heißt,
versandete 1825 das Dorf Alt-Neukrug. Als die Kirche damals nach dem
heutigen Neukrug verlegt worden war, wurde der Gottesdienst in der
Schule abgehalten, die noch nicht so stark der Gefahr der Versandung
ausgesetzt war. Sie wurde dann 1826 durch Feuer zerstört.
Die Narmeler Kinder gingen nun nach Neukrug zur Schule. Der Schulweg
war 8 km lang und im Herbst, Winter und Frühjahr sehr unangenehm, wenn
nicht ungangbar. Sie besuchten die Narmeler Kinder oft nur ein
Vierteljahr lang die Schule. Vom 1. Januar 1878 ab wurde daher in Narmeln
selbst zweimal wöchentlich von dem Neukruger Lehrer Schule gehalten.
1879 bekam Narmeln einen eigenen Lehrer, das Schulgebäude aber wurde
erst 1895 errichtet.
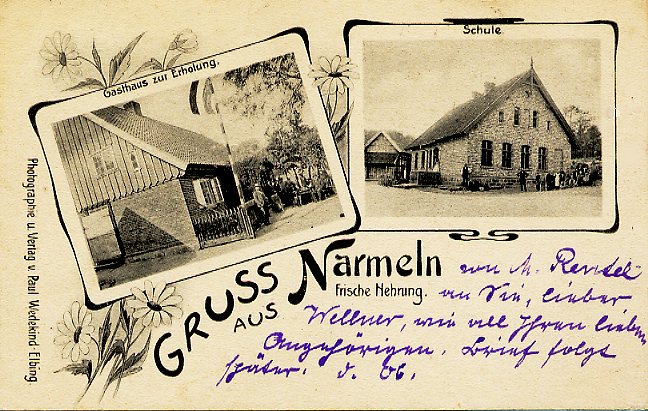
2.
Narmeln auf der Frischen Nehrung (am 1.7.1906 in Neukrug
gestempelt)
Zum Schulbau, der 15 000 Mark kostete, spendete Kaiser Wilhelm II.
9 600 Mark.
Kerstan, Lic. Dr. E. G.: Die Geschichte des Landkreises Elbing. Elbing:
Verlag der Elbinger Altertumsgesellschaft 1925, 473 Seiten, S. 271.

3.
Narmeln mit folgenden Motiven: Am Haff, Bäckerei
Badneck, Landungssteg und Schule

4.
Regatta der Fischerboote auf dem Frischen Haff vor Narmeln

5.
Fischer auf dem Bootssteg von Narmeln
Die Fischer von Narmeln
Die Fischer von Narmeln laufen zum Strand,
durch
weißen, feinpulvrigen Dünensand,
von abertausend Schritten
zermahlen
unter Last, in Freude, Sorgen und Qualen.
An der See
die Netze, aufgehängt,
jetzt in den offenen Kahn gezwängt.
Die
braunen Segel noch flattern im Wind.
Acht Boote wohl fertig zum Fang
nun sind.
Sie schieben sich in die Brandung hinein,
meist
Vater und Sohn bei der Arbeit zu zwei'n
Die nächtliche Brise sie
seewärts treibt.
Was heute wohl in den Netzen bleibt?
Sie
fangen die Flundern als willigste Beute,
und bringen in Braunsberg
sie unter die Leute.
Der letzte Zug! Zur Hinfahrt wird's Zeit.
Die
Sonne steigt und ein Boot reiht
sich flachbordig lose ans andere an,
durchnäßt
trotz Ölzeug fast jeder Mann.
Die dunklen Tuche steh'n steif im
Wind,
die hölzernen Schwerter pflügen geschwind
durch die
blaugraue, schwappige, kühle See,
die Kiefern und Dünen, da sind
sie in Lee.
Die Schoten gefiert flugs von schwieliger Hand,
der
bauchige Schiffsboden knirscht auf dem Strand.
Die Boote verholt, den
Fang sortiert,
durch die niedrigen Kusseln zum Dorf marschiert.
Aus
der offenen Halbtür wittern sie schon
nach schweren Stunden der
Arbeit Lohn.
Sie sitzen am weißgescheuerten Tisch
zur Abwechslung
gibt's mal heut wieder Fisch.
Becker, Herbert (Sohn des Försters in Grenzhaus) in Dobers, Klaus: Ostseebad Kahlberg - Frische Nehrung -
Bade- und Fischerleben von Pröbbernau bis Narmeln, hrsg. von Hans W. Hoppe und Hans-Jürgen
Schuch, Elbinger Hefte Nr. 37, Münster: Truso-Verlag 1985, mehrere Abb., 152 Seiten, S.
24.
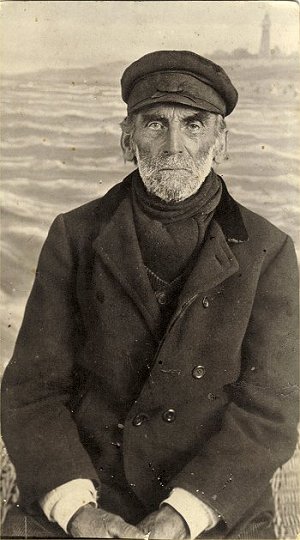
6.
Karl Hildebrandt, ein Fischer in Narmeln (ca. 1920-25 )
Das
Foto wurde von seinem Ur-Ur-Enkel zur Verfügung gestellt.
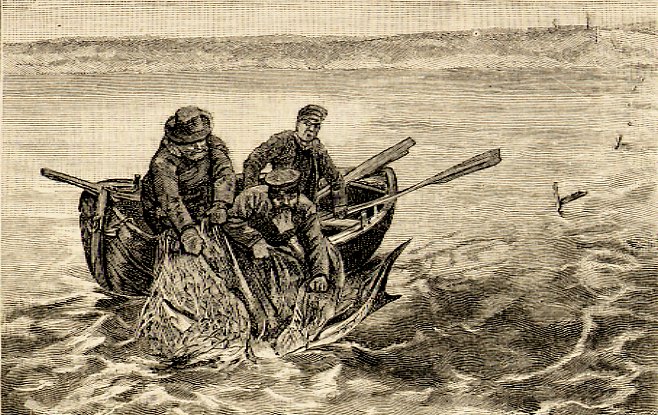
7.
Störfang - Holzstich nach einer Originalzeichnung von W. Wellner
aus dem Jahre 1887 (Illustrierte Welt)

8.
Holzstich nach einer Originalzeichnung von W. Wellner aus dem Jahre 1887
(Illustrierte Welt). Oben sieht man das Fischerdorf Narmeln mit zum
Trocknen aufgehängten Fischernetzen. Links unten bereitet sich
ein Bernsteinfischer zum Aufbruch vor und daneben sieht man das Innere
einer Fischerwohnung.
Der Unfruchtbarkeit des Landes entsprechend
ist die Lebensweise der Bewohner. Der Fischfang ist ihre
hauptsächlichste Nahrungsquelle. Die bedürftigen Hütten, in denen sie
wohnen, sind in ihren ganzen inneren Einrichtungen auf die häuslichen
Beschäftigungen zugeschnitten, welche der Fischfang erfordert. Die
ganze Familie sitzt am Herde versammelt, um die Netze für den
Störfang auszubessern oder die Aalangeln für den nächsten Tag
herzustellen. Die letztere Beschäftigung ist besonders die der Kinder
und alten Leute. Kleine Fische, Stinte genannt, die in den
ostpreußischen Gewässern überall zu Hunderttausenden ihr Wesen
treiben, werden in mehrere kleine Stücke geschnitten und jedes von
ihnen auf einem Angelhaken befestigt. Die Aale ziehen diesen Köder
jedem anderen vor. Abends werden die Angeln ausgelegt um morgens
eingezogen zu werden.
"Von der Frischen Nehrung" aus Illustrierte Welt von
1887.
Zum Fang auf der Ostsee dienten als Fahrzeuge
die sogenannten Lommen, Segelboote mit zwei Sprietsegeln hintereinander,
trapezförmigen Längssegeln, die von einer unten am Mast sitzenden, diagonal
angebrachten Stange, dem Spriet, gehalten wurden. Diese Lommen hatten keinen
besonders ausgebauten Kiel, sondern ein Schwert, weil dieses, besonders bei
rollender See, ein besseres Steuern erlaubte. Sie glichen den auf dem Haff
gebräuchlichen "Sicken", unterschieden sich aber von ihnen dadurch,
dass sie größer und breiter waren und kein "Raum"
(Wasserbehälter) hatten. Die Boote eigneten sich besonders gut für die
Küstenfischerei, weil sie ohne Ballast einen geringen Tiefgang hatten, beim
Landen in stürmischem Wetter gut durch die Brandung kamen und sich leicht in
die schützenden Dünen ziehen ließen. Die Besatzung einer solchen Lomme
bestand gewöhnlich aus vier Mann, von denen jeder die gleiche Anzahl von
Netzen beisteuerte.
Eine willkommene Nebeneinnahme bot den Fischern
die der Bergung des angeschwemmten Bernsteins. Die blaue
Erde, jene tertiäre Schicht, die der Hauptlieferant des begehrten
Minerals war, erstreckte sich von der Küste des Samlandes weit
unter der Ostsee hin. Wenn starke Stürme den Boden der See aufwühlten,
wurde der wertvolle Stein meist zusammen mit den Tangmassen, die bei
dieser Gelegenheit gleichfalls vom Grund abgerissen wurden, an Land
gespült.
Die Narmeler Fischer vermieteten ihre Wohnungen oft an
Feriengäste und begnügten sich selbst mit einer Unterkunft im
Stall.
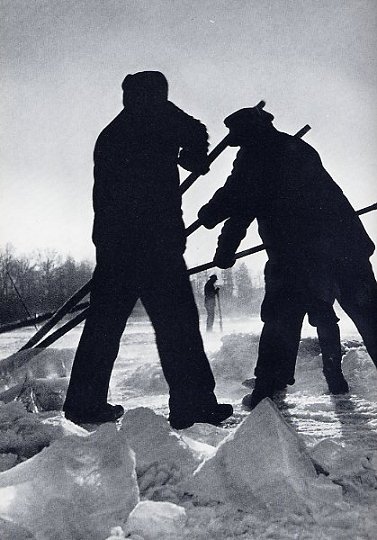
9.
Eisfischer im Haff
Im Winter betrieb man Eisfischerei. Dazu verwandte man
Bressen- und Zandernetze. Man schlug mit Eisäxten Wunen in das Haffeis und
brachte dann eine 10-20 Meter lange Stange ins Wasser, die mit Hilfe einer
Holz- oder Eisengabel von einer Wune zur anderen befördert wurde. Am Ende der
Stange war eine starke Schnur befestigt , mit der die Netze im Wasser
weitergezogen wurden. Diese Netze wurden an Ringen im Haffboden befestigt. Die
Segelschlitten, die sie dabei benutzten, waren so kräftig gebaut, dass sie
Männer und Zubehör zu tragen vermochten.
Mielcarczyk, Georg: Narmeln - Neukrug - Vöglers - Ein Kirchspiel auf der
Frischen Nehrung, Bremerhaven: Truso-Verlag 1981, einige Abb., 101 Seiten,
Text S. 37, 38, 41, 43, 52.
Lorck, Carl von: Ostpreußen - Eine Erinnerung an Ost- und Westpreußen
und Danzig mit 122 Fotografien und 23 Seiten Text. Abb. S. 124
(Eisfischer)
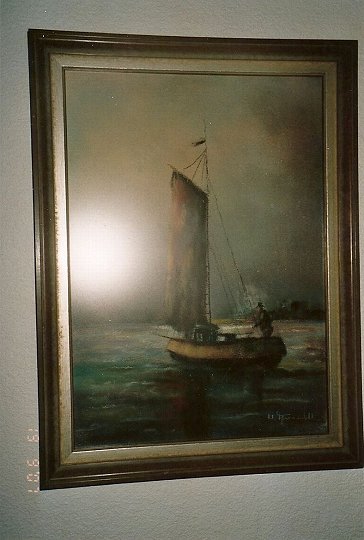
10.
Gemälde
einer Überfahrt von Alt-Passarge zur Frischen Nehrung
(von Herrn Günter Schött zur Verfügung gestellt)
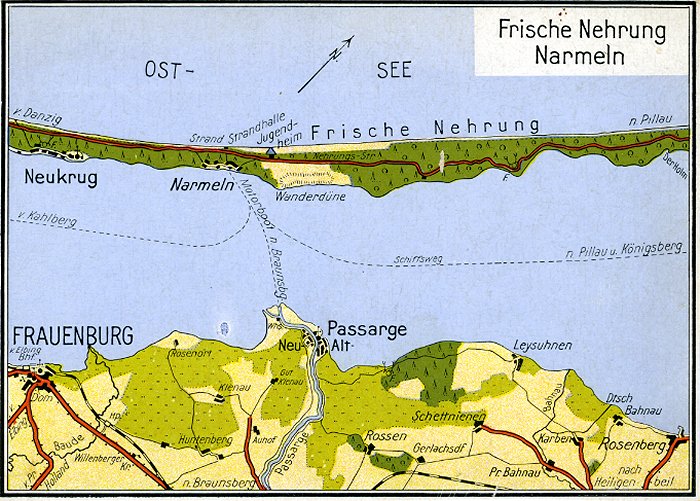
11. Frische Nehrung: Kartenausschnitt mit Neukrug, Narmeln und der
dortigen Wanderdüne
Wanderdünen - eine Bedrohung für
Narmeln und seine Umgebung
Einst war die
gesamte Nehrung von einem Laub-, und später von einem Mischwald
bedeckt. Ab dem 15. Jahrhundert setzten schwedische Kohlebrenner, Kriege
und starkes Abholzen dem Nehrungswald schwer zu. Kriegerische
Auseinandersetzungen führten dazu, dass Waldstreifen um Festungen
herum gerodet wurden und dass Blickschneisen durch Brandrodung
entstanden. Das Graben nach Bernstein zerstörte ebenfalls den Bewuchs.
Vermutlich
ist für das Verschwinden des Nehrungswaldes im Laufe des 18. und 19.
Jahrh. auch das Sinken des Grundwasserspiegels infolge der umfangreichen
Entwässerungsarbeiten im Danziger Werder mitverantwortlich.
Damals nämlich begannen die bis dahin auf den tiefer gelegenen Stellen
der Nehrung gut gedeihenden Laubbäume zu verkümmern und gingen
ein.
So war im Laufe der Jahre der bloßgelegte Dünensand unter
dem Einfluss des Windes ins Wandern geraten.
In dem Buch von Kerstan "Die Geschichte des
Landkreises Elbing" können wir nachlesen, dass schon während des
ersten schwedisch-polnischen Krieges (1626-35) in Narmeln zwölf Häuser
von einer Wanderdüne begraben worden sind.
Außerdem wurden im
Laufe der Zeit die Dörfer
Schoite (1593), Schmergrube (ca. 1728), Alt-Vöglers, das erste Neukrug
(1826), und Neudorf von den Bewohnern geräumt und sind vom Sand
verschüttet worden.
Dobers, Klaus: Ostseebad Kahlberg auf der Frischen Nehrung. Bade- und Fischerleben von Pröbbernau bis
Narmeln. Elbinger Hefte Nr. 37. Münster: Truso-Verlag, 1985,S. 24.
Um 1750 waren die Zustände so schlimm, dass die Nehrunger den
Danziger Rat inständig um Hilfe baten. Dieser versuchte zunächst der
Versandung Herr zu werden, indem er Sandgraskulturen anlegen ließ und
Sandfangzäune errichtete. Die Arbeiten leitete seit 1795 der aus
Dänemark gebürtige Danziger Kranmeister Sören Björn. Während der
Napoleonischen Zeit ruhten die Arbeiten. Erst die neue preußische
Regierung beschloss die Arbeiten wieder aufzunehmen. Mit ihrer
Durchführung beauftragte sie den Düneninspektor Krause.
Zu diesem Zeitpunkt fand man zwischen der ostpreußischen Grenze und
Kahlberg nur noch Wanderdünen, die durchschnittlich etwa 4 m im Jahr
voranrückten.
Zunächst wurden widerstandsfähige Vordünen geschaffen, bevor man die
Wanderdünen mit einem Netz von Sandgraskulturen überzog. Um 1823 war im
wesentlichen der Wald von Kahlberg geschaffen. Aber in der Dünensektion
zwischen Kahlberg und der ostpreußischen Grenze sah es noch böse aus,
denn hier hatte man mit der Arbeit noch überhaupt nicht begonnen. Die
Dörfer Vöglers, Neukrug und Narmeln schwebten in höchster Gefahr. 1825
wurde die Kirche von Neukrug vom Sand begraben.
Bei Narmeln war eine 30 m hohe Düne, die in 3 Jahren eine Wanderung von
80 m zurückgelegt hatte, bis dicht an das Dorf herangerückt und hatte es
in drei verschiedene Teile aufgesplittert. In letzter Minute konnte das
Dorf vor der drohenden Vernichtung gerettet werden, als in den Jahren
1833-1838 die Festlegung der unheilvollen Dünenmassen gelang.
Schließlich wurden auch die Dünen zwischen Schmergrube und Neukrug
befestigt. Das ursprünglich angewandte Verfahren zur Festlegung der
Sandmassen war inzwischen durch ein besseres ersetzt worden.
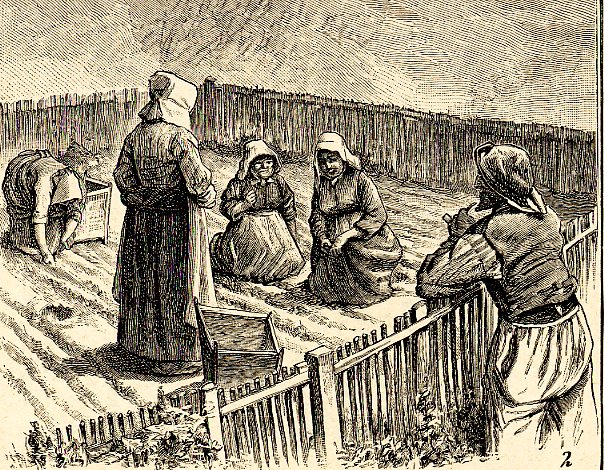
12. Pflanzgarten für junge Kiefern - Holzstich nach einer
Originalzeichnung von W. Wellner aus dem Jahre 1887 (Illustrierte
Welt)
Man teilte den Boden der Düne in
Vierecke von etwa 3 x 3 Meter auf, die man mit Strauchzäunen von ca. 50
Zentimeter Höhe umgab. In ein mit Haffschlick gefülltes Loch in der
Mitte steckte man ein Pflänzchen der aus den Alpen stammenden Hakenkiefer
(Pinus montana var. unicata), die im Laufe des Wachstums mit ihren
breit ausladenden Ästen große Teile des Sandes bedeckten. Der Boden
innerhalb des Vierecks wurde mit kleingehacktem Strauchwerk bedeckt, um
das Davonfliegen des Sandes zu verhindern.
Die Aufforstung der Dünen
wurde zum großen Teil von Strafgefangenen ausgeführt, die in Baracken
bei Schmergrube und Neukrug während der Sommermonate untergebracht waren.
Bei der weiteren Unterhaltung des neu geschaffenen Waldes fanden
viele Bewohner der Nehrungsdörfer, meist Frauen, lohnende Beschäftigung
und Verdienst. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts fing man an,
die Vordünen mit Strandhafer zu befestigen.
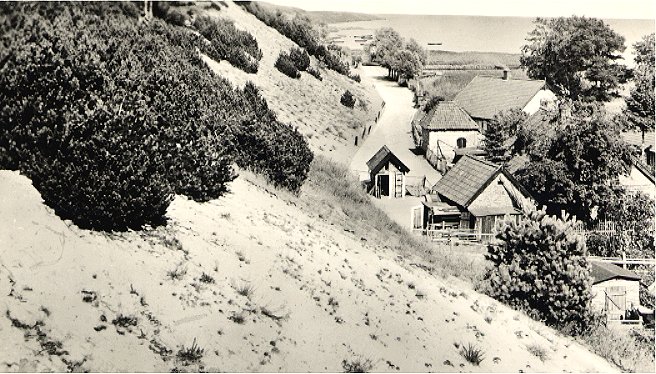
13. Die Wanderdüne von Narmeln ca. 1933
Nur östlich von Narmeln, etwa auf der Hälfte der 57 km langen
und 1 bis 3 km breiten Nehrung ließ man eine Wanderdüne bestehen. Als
einzige auf der Nehrung wurde sie nicht befestigt. Fast zwei Kilometer
ist sie lang und 26 Meter hoch. Südlich zu ihren Füßen liegt - besser
sagt man lag - Narmeln; nun nicht viel mehr als eine Unterkunft für die
letzten militärischen Grenzposten. Die polnisch - russische Grenze
verläuft zwischen Narmeln und Neukrug. Hier beginnt also das Gebiet, das in der
Zeit des kalten Krieges (von 1945-1990) Sperrgebiet war und sich zu einem
Reservat entwickelt hat. In diesem westlichsten Teil Russlands liegt die
Ostseeflotte der Roten Armee bei Königsberg (Kaliningrad).

14.
Wanderdüne bei Narmeln
Quellen: Ausschreibung: Exkursion II - 2003, Biologische Station - Frische Nehrung
http://www.biologie.uni-rostock.de/zingst/praktifrisch01.htm
Helmut Peitsch: Pillau-Neutief und die Frische Nehrung (Teil III). In: Das Ostpreußenblatt vom 22. April 2000
http://www.webarchiv-server.de/pin/archiv00/1600ob24.htm
Näheres in Dobers, Klaus: Ostseebad Kahlberg auf der Frischen Nehrung. Bade- und Fischerleben von Pröbbernau bis
Narmeln. Elbinger Hefte Nr. 37. Münster: Truso-Verlag, 1985,S. 29-36.
Kerstan,
Lic. Dr. E. G.: Die Geschichte des Landkreises Elbing. Elbing:
Verlag der Elbinger Altertumsgesellschaft 1925, 473 Seiten, S. 270.
Mielcarczyk, Georg: Narmeln - Neukrug - Vöglers - Ein Kirchspiel auf der
Frischen Nehrung, Bremerhaven: Truso-Verlag 1981, einige Abb., 101 Seiten,
Text S. 11-13.

15. Hochzeit von Fritz Littkemann u. Gertrud
geb. Wittke in Narmeln (ca. 1934)

16.
Hochzeit auf der Frischen Nehrung, Ort und Datum sind nicht bekannt

17.
Eiserne
Hochzeit von Johann Carl Gregorius u. Johanna Emilie Dahms (unten Mitte) am 29.10.1930
Links
unten sitzt Carl Eduard Dahms und rechts
unten Johanna Bertha Pahlke
Obere Reihe von links nach
rechts: Auguste Emilie Gregorius, Johann Adolf Gregorius, Johanna
Wilhelmine Schöttke, Maria Johanna Gregorius, Karl Popall, Auguste
Florentine Schöttke, Fritz Rudolf Gregorius, Auguste Wilhelmine Tuchel,
Karl Friedrich Littkemann, Mathilde Bertha Pahlke und Carl Albert
Gregorius. Informationen zu den verschiedenen Personen wurden von Herrn
Erich Hildebrandt, dem Urenkel des Jubelpaares zur Verfügung gestellt.
(Die drei Fotos wurden von Herrn Günter Schött
zur Verfügung gestellt.)
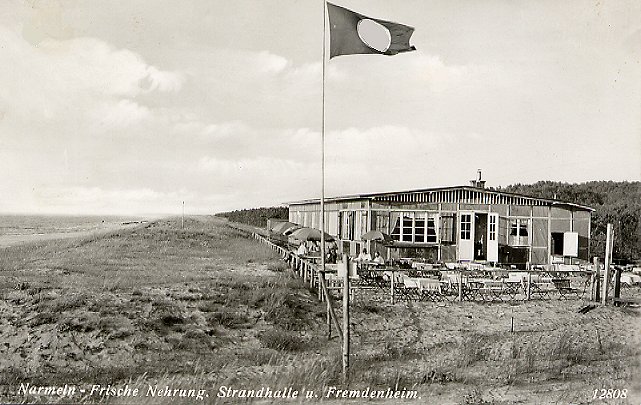
18.
Strandhalle und Fremdenheim M. Sergel in Narmeln.
Die Strandhalle mit einem kleinen Restaurant wurde im Jahre 1933
von dem Braunsberger Kaufmann Sergel erbaut. Nach zwei Jahren wurde sie
vergrößert und Fremdenzimmer eingerichtet. 1936 hatte die Strandhalle 16
Betten. Herr Sergel wurde 1940 zur Marine nach Pillau eingezogen und
verunglückte im August 1943 tödlich bei einem Motorbootunfall. Seine Witwe
stellte 1944 die Strandhalle der Luftwaffe zur Verfügung und verließ die
Nehrung.
Mielcarczyk, Georg: Narmeln - Neukrug - Vöglers - Ein Kirchspiel auf der
Frischen Nehrung, Bremerhaven: Truso-Verlag 1981, einige Abb., 101 Seiten,
Text S. 50+51.
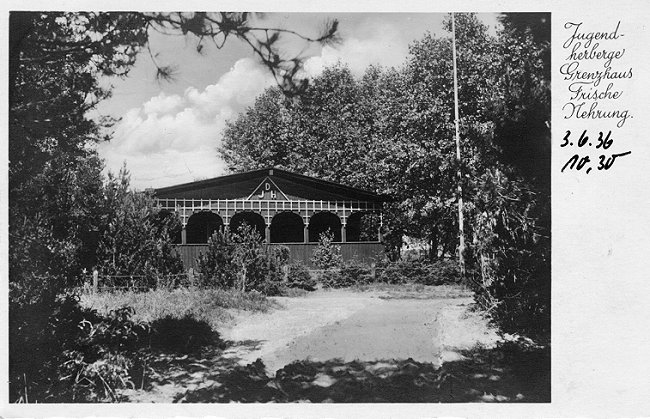
19. Jugendherberge Grenzhaus bei Narmeln auf der Frischen Nehrung
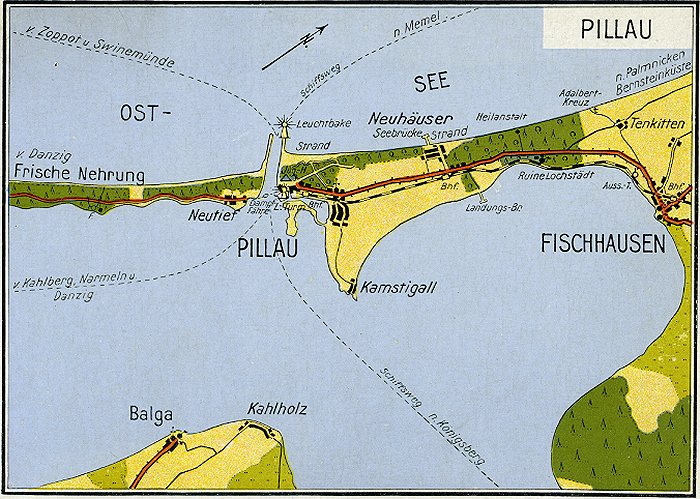
20.
Frische Nehrung: Kartenausschnitt mit Neutief, dem Pillauer Tief und von
Pillau bis Fischhausen

21.
Der Haffstrand von Neutief auf der Frischen Nehrung (15.1.1915)
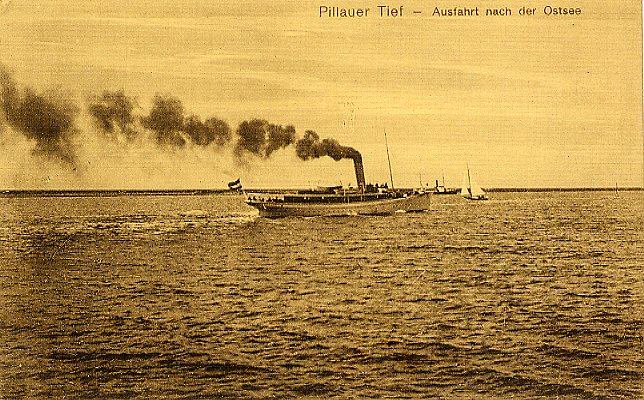
22.
Pillauer Tief - Ausfahrt nach der Ostsee
Die Stadt Pillau auf der Frischen Nehrung ist ein Vorhafen von Königsberg
in Preußen. Das Pillauer Tief (550 m lang und 360 m breit) verbindet die
Danziger Bucht der Ostsee mit dem Frischen Haff und dem Königsberger
Seekanal.
Sattler, Gert O. E.: Köstlichkeiten und
Besonderheiten aus Ost- und Westpreußen, Husum: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 1997,
120 Seiten, S. 82 und 83.

23.
Gruß aus der Ilskefalle in Pillau
unten
Mitte: ein Ilske (Iltis), unten links: Kriegsveteranen.
oben links: Stadtansicht mit S. M. Torpedo Sleipner (Seiner Majestät
Torpedoboot Sleipner),
oben rechts: die Ilskefalle.
Die Ilskefalle in Pillau war ein
weltbekanntes
Gebäude mit einem Kolonialwarenladen, einem Speiselokal, einer Hafenkneipe,
einem Tanzsaal und einem Speicher für die christliche Seefahrt.
Pillauer Ilskefalle
In Pillau in der Ilskefalle
da wurden Korn und Köm nicht alle,
da trank man Weinbrand auch im Tee
und echten Rum aus Übersee.
Der Speicher in der Ilskefalle
war groß wie eine Messehalle,
man kaufte alles, Seil und Sack,
den Zwirn, das Garn und Kautabak.
Im Marktgewühl der Ilskefalle
erwarben Heiner, Fritz und Kalle,
was man so braucht nach Seemannsart
im Hafen und auf großer Fahrt.
In Pillau in der Ilskefalle
ging jeder Seemann gern zum Balle
die Gretel tanzte mit dem Hans
und butschte ihn beim Walzertanz.
Sattler, Gert O. E.: Köstlichkeiten und
Besonderheiten aus Ost- und Westpreußen, Husum: Husum Druck- und
Verlagsgesellschaft 1997, 120 Seiten, S. 82 und 83.
Index
Copyright Christa Mühleisen
|