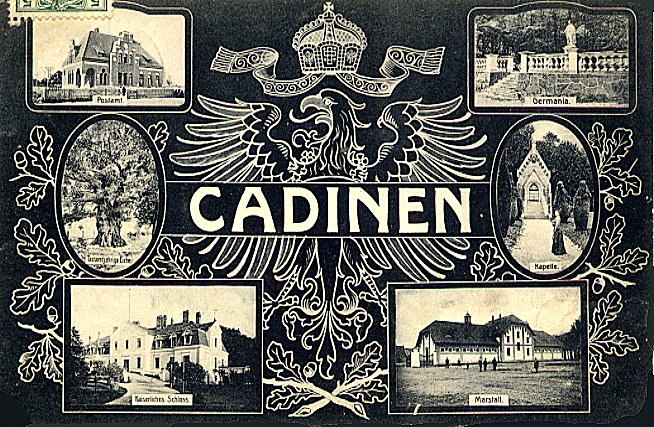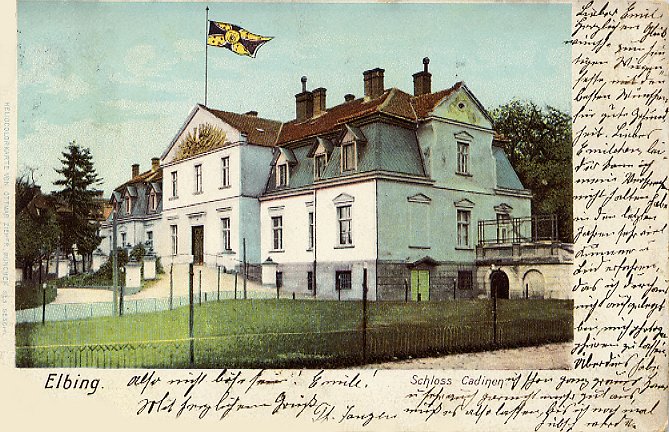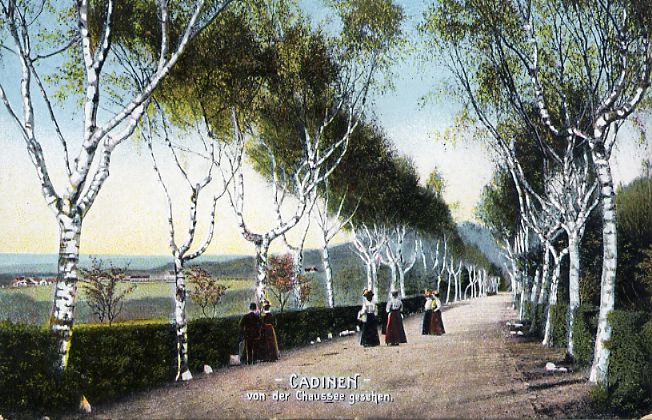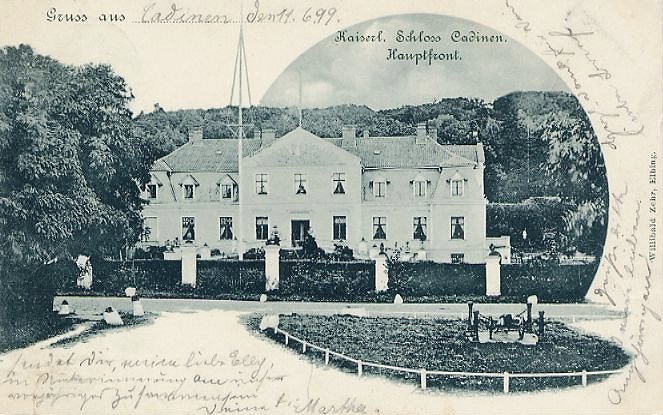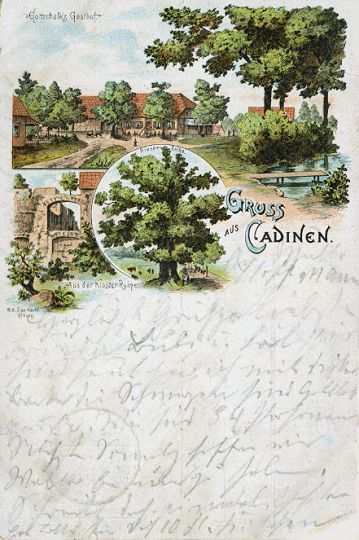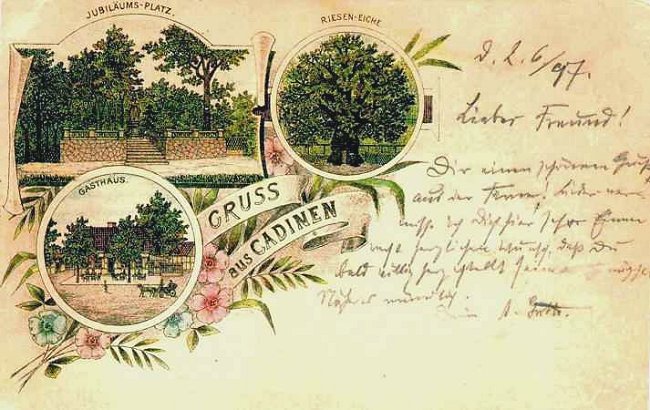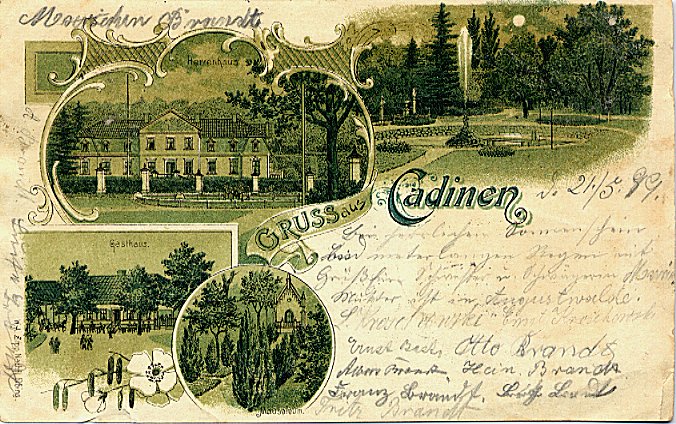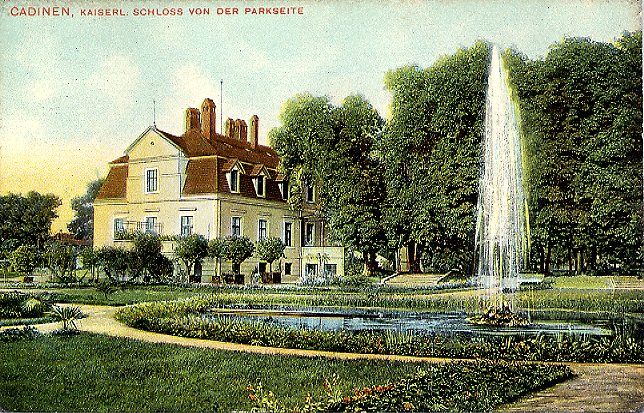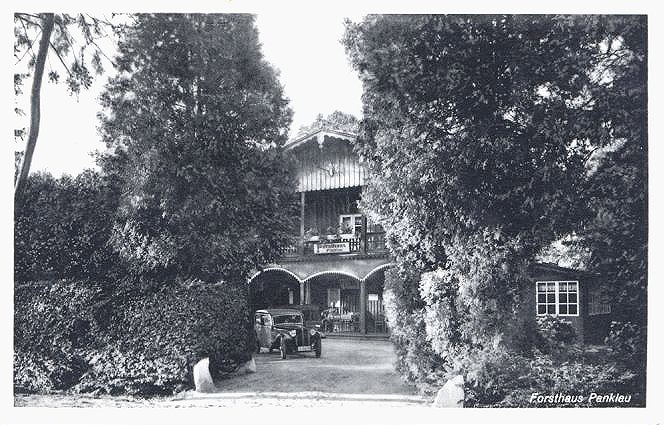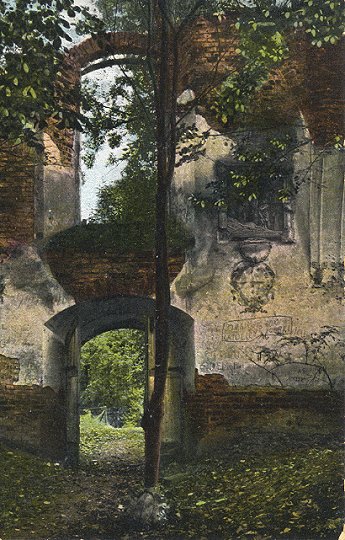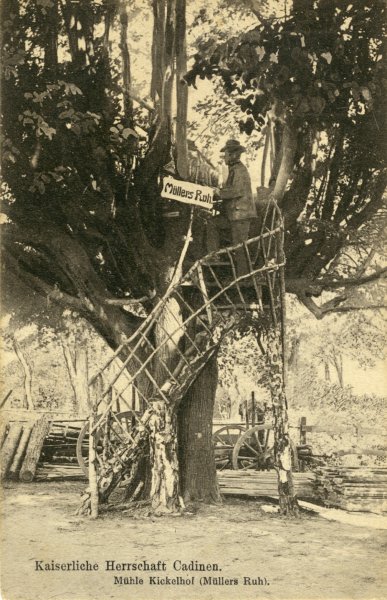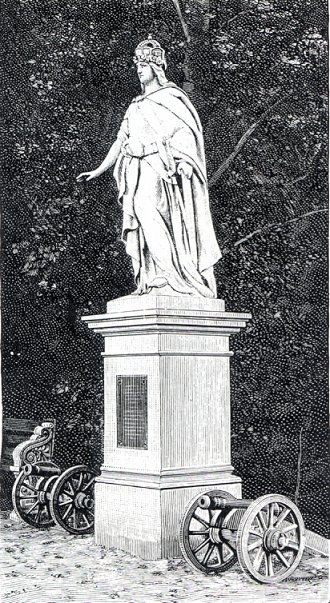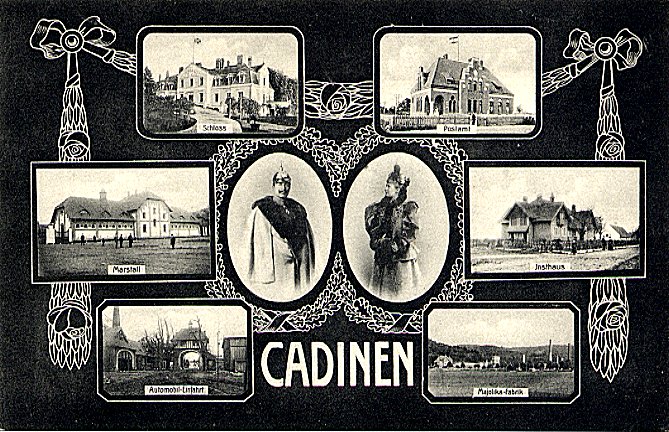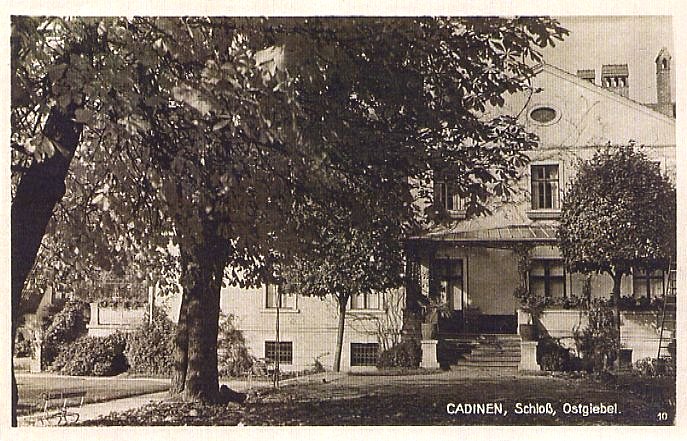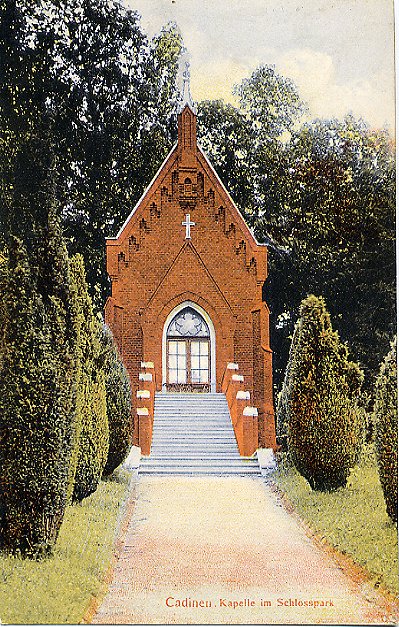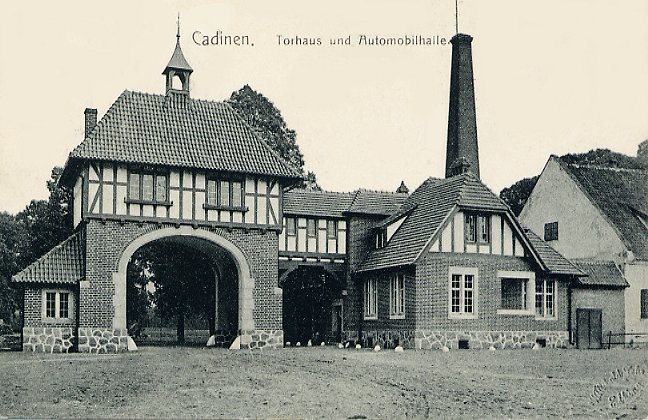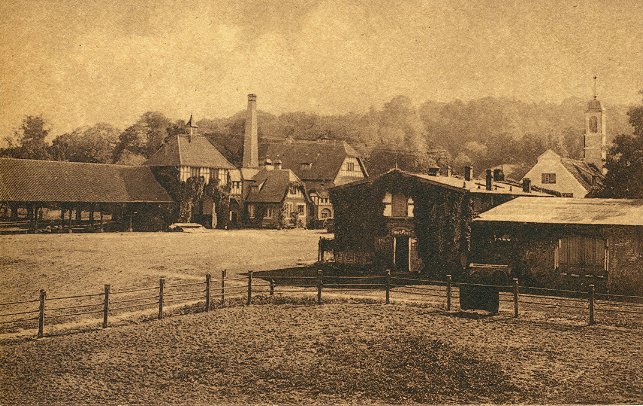|
Cadinen -
Teil
1 Bild 1: Auf
dieser alten Jugendstilkarte sieht man beginnend von links unten: das
Kaiserliche Schloss, die 1000-jährige Eiche, das Postamt, die
Germania-Statue von Calandrelli, die Kapelle (Mausoleum) und den
Marstall. Cadinen, später Kadinen, ist eine am
Frischen Haff gelegene Ortschaft im Landkreis Elbing. Sie gehört zu der
reizvollen Haffuferlandschaft, die sich nördlich von der Stadt Elbing
bis Wiek bei Tolkemit erstreckt. Daran schließt sich der ostpreußische
Teil der Haffküste bis Königsberg an. Im Rücken des Ortes liegt die
Elbinger Höhe, die östlich von Cadinen bei dem Dorf Neukirch - Höhe
bis auf 110 m ansteigt.
Nachdem
der preußische General Wilhelm Friedrich Karl Graf
von Schwerin, das Rittergut 1787 erworben hatte,
verschönte er es unter außerordentlichem Kostenaufwand ganz ungemein.
Es heißt, dass die beiden Wappen am Gutshaus aus dieser Zeit stammen.
Das eine Wappen soll das des Grafen Schwerin, das andere das seiner
Gattin sein. Nachdem er als Besitzer 12 Jahre später in Konkurs geraten
war, lösten sich die Eigentümer in schneller Folge ab.
Bild
4: Die Cadiner Chaussee hat einst der Graf von Schwerin
anlegen
lassen. Von hier hatte man einen schönen Ausblick auf das Gut.
(handkolorierte Ansichtskarte). Erika Kickton, die Tochter des
Baumeisters, der die Cadiner Kirche errichtet hat, schreibt über diese
Chaussee: " Endlich wuchsen schlanke weiße Pfeiler zu beiden
Seiten des Weges empor, die lichtgrünen Fähnchen der Birkenallee
schwankten im Sommerwind hin und her".
Auf
den Frauenburger Domherr Ignaz von Matty, den späteren Bischof
von Kulm, folgte nach einem halben Jahr als Besitzer dessen Danziger
Vetter, der Bankier Ignaz von Matty. Nach seinem Tode verkaufte
die Witwe das Gut an den Elbinger Bankdirektor Gotthilf Christoph von
Struensee. Es war der Bruder jenes dänischen Ministers, der 1772
hingerichtet wurde.
Bild
8: Diese Ansichtskarte (Lithographie) wurde am
22.5.1899 in Tolkemit abgestempelt und nach Alexisbad geschickt. Unten
in der Mitte sieht man das Mausoleum, das die Familie Birkner errichten
ließ und daneben das Gasthaus. Darüber befindet sich das Herrenhaus
und rechts davon die schöne Parkanlage.
Nach Alt-Elbinger Brauch wurden dann die
Wagen nach Cadinen vorausgeschickt. Die Ausflügler pilgerten zu Fuß
auf dem sogenannten Kirchensteig ins Tal, vorüber an den von dem
Landrat Karl Abramowski erschlossenen Aussichten. Im
Gasthausgarten in Cadinen neben der alten Schmiede, dem Gasthause
gegenüber, ein einer vom Staketenzaun umschlossenen Ecke, nahm man auf den
langen Holzbänken vor den einfachen, kaum behobelten Tischen Platz. Die
mitgebrachten Decken und Kuchenberge wurden von den Wagen geholt, die
schon längst auf dem breiten Platz vor dem Dorfkrug aufgefahren waren,
und bald stieg auch der würzige Kaffeeduft den wieder hungrig
gewordenen Teilnehmern in die Nase.
Dann suchte man den in ganz
Preußen rühmlichst bekannten schönen Park auf, den die beiden
Besitzer des Rittergutes Cadinen: John Erich und Arthur Birkner, für
alle sich würdig verhaltenden Fremden geöffnet hielten. Vorüber ging
es am sogenannten "Neuen Palais" oder
"Kavaliershaus" und an der weiß leuchtenden Orangerie,
davor in großen Kübeln stehende südländische Wunderbäume ihre
betäubenden Blütendüfte versprühten. Hoch und steil umzirkten
ernste, dunkle Buchenhecken mit davor gestellten massigen Laubpfeilern
einen weiten Halbkreis - ein Bild Ruhe und Frieden atmender edelster
Gartenarchitektur. Nun schritt man durch das Heckenportal. Dann führte
der Großvater seine Ausflügler etwas nach rechts. Hier tat sich den
erstaunten Blicken die stille Anmut eines kleinen Naturtheaters auf:
hohe grüne Wände säumten das Quadrat des tiefliegenden
Zuschauerraumes, daran schloss sich der Platz für das Orchester,
und dahinter stieg, von lebenden Kulissen eingerahmt und von einem
Hecken-Prospekt im Hintergrund begrenzt, das erhöhte Erdplateau des
Bühnenpodiums auf. Hier hatte der Großvater, noch ehe er als
Opernsänger zum Theater ging - und das war vor 1840 - agiert und
gesungen.
Die Klosterkirche war damals noch ganz gut
erhalten; in ihr pflegten Gesangvereine, die hierher Wanderungen
machten, ihre Chöre und Lieder vorzutragen. Auch traf man in dem
Klostergemäuer öfters buntbemützte Musensöhne der Königsberger Albertina, die, von der Romantik des Ortes angezogen, ihre sommerlichen
Burschenfahrten nach Cadinen unternommen hatten. Aus dem Bannkreis des
stillen Klosterfriedens gelangte man wieder zurück in den Park. Vom "Mullenberg"
ertönte unterdes lustiges Gelächter. In die schiefe Ebene der
Berglehne eingegraben, senkte sich eine mit Strohhalmen
ausgepolsterte Rinne hinab, auf der in einem großen Trog jeweils
3 Personen hinuntersausen konnten. Zwei herrschaftliche Diener der
Gutsbesitzer verdienten sich hier sonntags mit dem Betrieb dieser
beliebten Volksbelustigung ein Extra-Dittchen. Erst als die Dämmerung
hereinbrach, rüstete man sich wieder zur Abfahrt". Bild
16: Hier ist dasselbe Speichergebäude einige Jahre später zu sehen.
Inzwischen wurde es umgebaut. 1878, nach dem Tode seines Bruders Erich, war Arthur Birkner
der alleinige Besitzer Cadinens. Er ließ für seinen Bruder
Erich das Mausoleum im Park erbauen, in dem der Erbauer mit seiner
Gattin später selbst beigesetzt wurde. Arthur Birkner brachte das
Gut in wirtschaftlicher Beziehung zunächst in die Höhe, auch erwarb er
1881 das Gut Kickelhof und 1883 die Kickelhöfer
Mühle. Um 1890
suchten aber empfindliche Brände Cadinen heim, dabei brannten die
Wirtschaftsgebäude in Kickelhof und die Ställe und Scheunen in Cadinen
ab. 1889 feierte die Familie Birkner ihr 75jähriges Besitzjubiläum in
Cadinen. Damals wurde die von Freunden Birkners gestiftete
Germaniastatue von Calandrelli auf einer noch heute erkennbaren Stelle
im Park aufgestellt. Nach dem Tode von
Erich Birkner im Jahre 1898 ging das Gut Cadinen bei Übernahme
der Schulden und Aussetzung einer Leibrente von dem kinderlosen Arthur
Birkner in den Besitz des preußischen Königs und deutschen Kaisers
Wilhelm II. über. Hier bestanden neben der Landwirtschaft ein
größerer Waldbesitz mit jagdbarem Wild - möglicherweise der
eigentliche Grund für Wilhelm, das Gut zu übernehmen - und Tongruben
mit einer Ziegelei, wie oft in diesem Landstrich am Frischen Haff. Mit
dem neuen Besitzer begann eine Blütezeit für Cadinen.
Bild
20: Auf dieser Jugendstilkarte mit den Porträts von Kaiser Wilhelm
II. und der Kaiserin Auguste Victoria sieht man beginnend von links
unten: die Autombil-Einfahrt, den Marstall, das Schloss, das Postamt,
ein Insthaus und die Majolika-Fabrik. Am
2. Juni 1899 inspizierte Wilhelm II. Cadinen und bereits am 5. und 6.
Oktober 1899 erfolgte der zweite Besuch, diesmal mit der Kaiserin. Es
zeigte sich, dass vieles zu erneuern und zu verändern war und das
geschah dann auch. Der Kaiser investierte erhebliche Mittel in seinen,
allerdings stark heruntergekommenen Besitz, der seiner Familie als
Sommerresidenz dienen sollte. Das Gutshaus wurde teilweise verändert und damit das
Herrenhaus vergrößert, die Einrichtung erneuert. Seitdem wurde es
allgemein und überall "Schloss" genannt. Schließlich hatte
ein Kaiser in einem Schloss zu wohnen.
In der Kaiserzeit wurde
das Mausoleum zur Gutskapelle, in der viele Gottesdienste abgehalten
worden sind, bis die Cadiner Kirche, die der Kaiser errichten ließ, in
Benutzung genommen wurde.
Die große Automobilhalle für die Fahrzeuge
des Kaisers, bei der sich auch eine sehr gut ausgestattete Werkstätte
befand, konnte sechs große Automobile bequem aufnehmen. Aus einem
eisernen Bassin, das drei Meter feuersicher unter der Erde liegt und
etwa 2000 Liter Benzin fasste, wurden die Automobile gespeist. In dem
Automobilgebäude befanden sich auch die Unterkunfts- und
Verpflegungsräume für das Bedienungspersonal der Autos und für die
zahlreiche kaiserliche Dienerschaft. Bei den Cadiner Kindern wurde
das Gebäude wegen seiner Größe "Flugzeughalle" genannt.
Die
Haffuferbahn hat auf ihrer Fahrt nach Elbing Cadinen erreicht. Für
seine Besuche konnte der Kaiser direkt mit seinem "Hofzug", ohne diesen in
Elbing verlassen, seinen Besitz erreichen.
Der
Kaiser liebte Cadinen sehr und war jedes Jahr zweimal auf seinem
westpreußischen Rittergut. Auch die Kaiserin und die Kinder weilten
gerne in Cadinen. Copyright Christa Mühleisen |