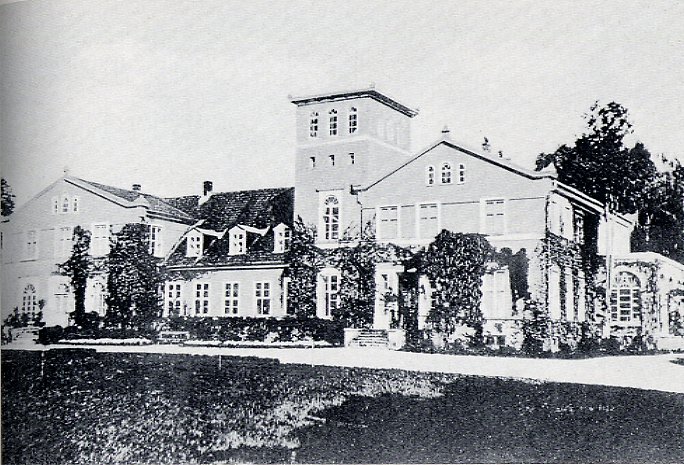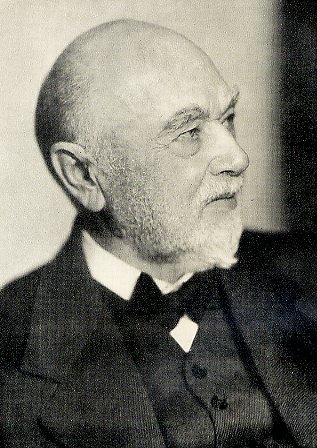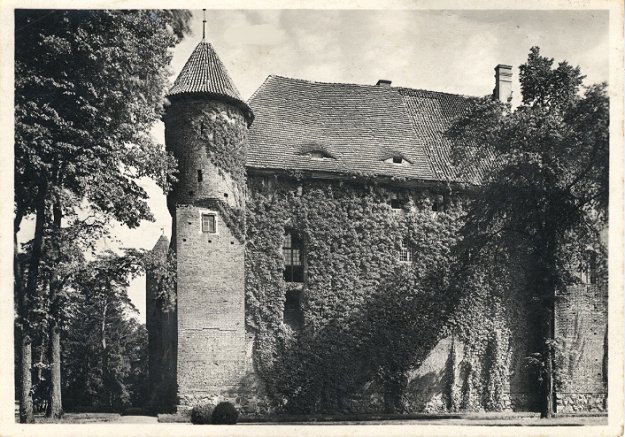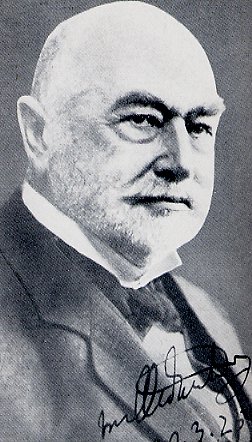|
Das Gut Januschau / Januszewo
Teil
1
Das schöne spätklassizistische
Schloss (18.-20. Jahrh.) mit einem Neubarockflügel, die Vorderfront mit Efeu
geschmückt, musste man tief im wohl gepflegten Park suchen. Es lag
inmitten von mächtigen Baumriesen gebettet und blieb dem Auge des
Wanderers verborgen, bis die Waldblende durchschritten war. An dem weit
ausladenden Gutshof standen die schmucken neuen Gutsarbeiterhäuser, die
Schmiede, die Schule und am Wege nach Zollnick, wo sich das Forsthaus
befand, eine große Brennerei.

Bild 1: Schloss Januschau
Am 20. März 1855 wurde der spätere Besitzer von
Januschau, der Kammerherr von Oldenburg,
in Beisleiden (Ostpreußen) geboren und erhielt in der Taufe die Namen
Elard Kurt Maria Fürchtegott.
Die Oldenburgs sind ein bremisches
Uraldels-Geschlecht, das erstmals im Jahre 1247 urkundlich erwähnt wird.
Erst der Urgroßvater des Elard von Oldenburg wanderte von
Mecklenburg aus und trat als Offizier in preußische Dienste. Unter
Friedrich dem Großen stieg er die Sprossen der militärischen
Hierarchie empor und wurde frühzeitig Flügeladjudant des großen
Königs. Nach dem Siebenjährigen Krieg nahm er den Abschied, bekam vom
alten Fritz eine goldene Uhr zum Geschenk, heiratete Dorothea von der
Trenck und wurde Gutsbesitzer.
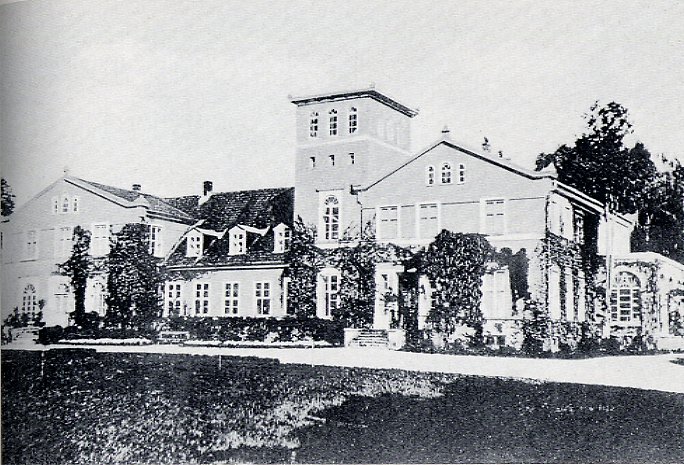
Bild
2: Schloss Beisleiden (poln. Bezledy) Kr. Preußisch Eylau
Der Großvater,
zunächst Soldat, kaufte 1801 das Gut Beisleiden. Dieses Gut, das er
fast 50 Jahre bewirtschaftete, übernahm der Vater 1843. In 1. Ehe war
der Vater mit der Freiin Brunsig von Brun verheiratet, mit der er drei
Töchter und einen Sohn hatte, der frühzeitig starb. Aus seiner 2.
Ehe mit Maria von Arnim entstammte Sohn Elard. Er war der vierte Sohn
aus dieser Verbindung. Die beiden ältesten Söhne starben schon als
Kinder, während Elard und sein älterer Bruder im Elternhause
aufwuchsen und dort eine glückliche Kindheit verbrachten.
Im Jahre 1862 kaufte der Vater
des Kammerherrn das östlich von Rosenberg gelegene Gut Januschau, um seinem Sohn Elard später einen
landwirtschaftlichen Besitz hinterlassen zu können.
Doch wurde das Gut
zunächst noch viele Jahre von Beisleiden aus verwaltet. Der junge Elard
drückte indessen die Schulbänke in Königsberg, Wernigerode,
Brandenburg und Halle. Dann wurde er Soldat. Nach bestandenem
Fähnrichsexamen ist er bei dem 2. Garde-Ulanen- Regiment in Berlin
eingetreten, wo er 1875 zum Leutnant befördert wurde. Er war mit
Leib und Seele Soldat. Dennoch nahm er 1883 seinen Abschied, um auf
Januschau Landwirt zu werden.
Er übernahm das Gut mit der
Verpflichtung, dem Vater jährlich 9000 Mark zu zahlen. Da das Gut
bisher 30 000 Mark abgeworfen hatte, war der Start günstig für
ihn. Januschau hatte eine wundervolle Schafherde mit Bockverkauf,
stellte 10 Remonten (für die Wehrmacht bestimmte, noch nicht
zugerittene Pferde) und zog jährlich 20 Kälber von den vorhandenen 20 Kühen auf, die im
übrigen für Haushalt und Deputate gebraucht wurden. Die Einnahme des
Inventars betrug etwa 27 000 Mark, wovon die Wolle, die pro Zentner etwa
160 Mark brachte, die Pachtsumme deckte. Der Getreideverkauf belief sich
auf etwa 33 000 Mark.
Indessen hatte er als Junggeselle zunächst
allerlei Sorgen. Der bisherige Verwalter machte sich selbständig und
kündigte. So musste er sich mit einem jungen zweiten Inspektor und zwei
Hofleuten behelfen. Die Mutter des Elard von von Oldenburg-Januschau
besorgte ihrem Sohn eine Köchin, die leider den Nachteil hatte, dass
sie miserabel kochte. Er kaufte also ein Kochbuch, stellte vier Gerichte
zusammen und sage zu ihr: "Diese Gerichte kochen Sie jetzt solange,
bis Sie sie können. Dann wollen wir einen Schritt weiter gehen."
Sie ist acht Jahre in Januschau geblieben und kochte schließlich
ausgezeichnet.
Damals befanden sich in Januschau nur drei eingerichtete
Zimmer: das Wohnzimmer des Vaters, sein Schlafzimmer und ein
Fremdenzimmer. Eine glückliche Fügung hatte es aber mit sich gebracht,
dass im Laufe des vorangegangenen Sommers in Beisleiden die Nachricht
eintraf, der Stab eines Infanterie - Regiments von sieben Offizieren
würde in Januschau einquartiert werden. Darauf erbat der Inspektor vom
Vater eine Anweisung, wie er sich die nötigen Betten und Esssachen
beschaffen solle. Der Vater sagte daraufhin zu seinem Sohn: "Fahre
nach Königsberg, kaufe sieben anständige Betten nebst der notwendigen
Einrichtung für Gaststuben. Die können dann in Januschau bleiben. Ich
schenke sie dir." Außerdem schenkte er ihm das Geschirr für 24 Personen,
und die Mutter besorgte die notwendige Wäsche.
Die Übernahme
von Januschau fiel in das Jahr 1883. Er lebte noch zwei Jahre in guten
landwirtschaftlichen Verhältnissen. Mit Eifer
stürzte er sich in alle Einzelheiten der Landwirtschaft hinein und
lernte die Bewirtschaftung eines Betriebes vom Gesichtspunkt desjenigen,
der die Verantwortung für das Ganze trägt. Er war noch jung genug, um
etwas zu wagen, so dass er zwei Jahre später das anliegende Gut Brausen
mit 3800 Morgen hinzukaufte. Dieser Zukauf von Brausen - für den Morgen
zahlte er 48 Taler - vermehrte seine landwirtschaftliche Erfahrung um
Vieles. Dieses Gut übernahm er in einem völlig herabgewirtschafteten
Zustand und war gezwungen, ein ganzes Jahr lang Brausen mit Stroh,
Futter und Brot aus Januschau zu beliefern.
Der Versuch, die
Wirtschaften von Januschau und Brausen so zu leiten, dass beide
Güter aufeinander abgestimmt waren, kostete unendlich viel Zeit,
Mühe und Geld. Erst nach langen Jahren konnte er den Versuch als
geglückt bezeichnen. Auf der anderen Seite von Januschau kaufte er noch
das Waldgut Zollnick von 2700 Morgen für 36 000 Taler. Dieser Kauf
bewährte sich von Anfang an. Alle drei Betriebe lagen mit der
Grundfläche dicht geschlossen beieinander. Abgesehen von der Schafzucht,
er hatte etwa 3000 Stück, spielte während der Zeit vor dem Kriege die
Erzeugung von Hafer und Weizen die Hauptrolle. Erst nach dem Kriege
verdrängte der Roggen den Weizen.
Seine frisch erworbenen
landwirtschaftlichen Kenntnisse konnte Elard schon bald an den Mann
bringen, denn im Jahre 1888 starb sein Vater. Da der Sohn seines
verstorbenen Bruders
noch minderjährig war, musste er auch auf dem väterlichen Gute in
Beisleiden die Zügel der Verwaltung in die Hand nehmen.
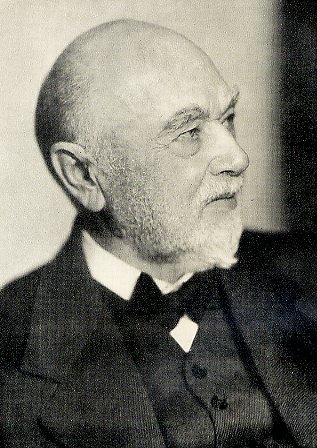
Bild 3: Elard von Oldenburg - Januschau Kammerherr (
20.3.1855 - 15.8.1937)
Elard
von Oldenburg-Januschau schreibt in seinen Lebenserinnerungen:
"Hatte mein Leben durch meine Tätigkeit als Gutsbesitzer eine neue
Richtung bekommen, so nahm es im Jahre 1884 wieder eine neue Wendung,
als ich die Gräfin Agnes von Kanitz zu meiner Frau machte. Über
fünfzig Jahre sind wir miteinander verheiratet, und seit dieser Zeit
teilt meine Frau Freud und Leid, Sorgen und Glück rückhaltlos mit mir.
Ihr allein verdanke ich mein ganzes persönliches Glück in den Jahren
unserer Ehe. Sie schenkte mir drei Töchter, die alle ziemlich früh
heirateten, so dass ich heute auf die stattliche Zahl von achtzehn
Enkeln blicken kann. Meiner Frau gebührt der Verdienst dafür, dass
mein Lebensweg durch ein glückliches Familienleben in meinem
Hause begnadet wurde. Mit ihr zusammen habe ich aus Januschau das
gemacht, was es geworden ist.
Sie war das zwölfte Kind aus dem
Hause Podangen. Ihr einer Bruder, der Landrat Graf Kanitz, war einer der
bedeutendsten Parlamentarier seiner Zeit, der sich auch als Landwirt
einen großen Namen machte. Die anderen Brüder waren Soldaten in hohen
Stellungen und Ämtern. Mit meiner Heirat kam ich in ein hochpolitisches
Haus hinein. Eine der interessantesten Persönlichkeiten war vor allem
der Mann einer meiner Schwägerinnen, der bekannte General Graf Heinrich
von Lehndorff. Er war Generaladjudant des alten Kaisers gewesen."

Bild 4: Maria Gräfin Lehndorff geb. von Oldenburg (9.7.1886 -
25.1.1945)
Elard
von Oldenburgs Tochter Maria (9.7.1886 - 25.1.1945) heiratete den
Landstallmeister Siegfried Graf von Lehndorff (11.4.1869 - 6.4.1956), der
die preußischen Gestüte von Graditz, Trakehnen und Braunsberg leitete.

Bild 5: Siegfried Graf von Lehndorff Landstallmeister (11.4.1869 -
6.4.1956)
Schon
dessen Vater Georg Graf von Lehndorff (4.12.1833 - 29.4.1914) war als
Oberlandstallmeister auf Graditz. Die Leidenschaft für Pferde hat sich
in dieser Familie von einer Generation auf die nächste vererbt.

Bild
6: Georg
Graf Lehndorff Oberlandstallmeister (4.12.1833 - 29.4.1914)
Gräfin Marie
fuhr mit ihren Kindern solange sie in Graditz lebten, jeden Sommer für
vier bis sechs Wochen nach Januschau zu ihren Eltern. Die Kinder
erwarteten die Fahrt jedes mal mit großer Spannung, denn Januschau war
ihr zweites Zuhause. In Deutsch-Eylau warteten zwei Wagen auf sie und
ihr Gepäck. Die Fahrt mit der Pferdekutsche dauerte eineinhalb Stunden.
Sie führte zunächst auf holprigem Pflaster durch die ganze
langgezogene Stadt, am Geserichsee vorbei und dann in nördlicher
Richtung durch den Wald, der zu Schönberg gehörte. Wenn man aus diesem
Wald wieder herauskam, sah man nach einer Weile zur linken Hand die
Türme des Schlosses Schönberg aus den Baumwipfeln herausragen.
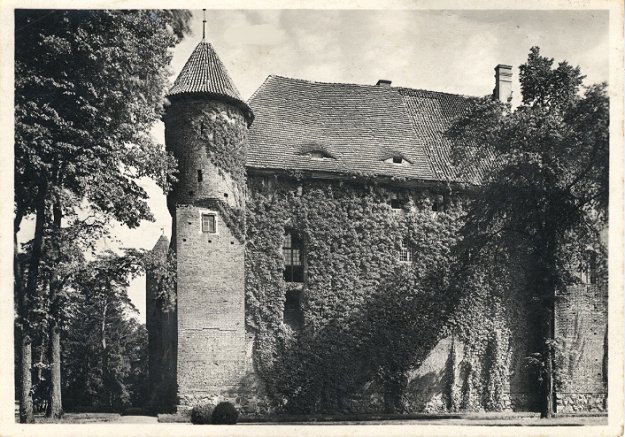
Bild 7: Schloss Schönberg
Dann
fuhr man noch etliche Kilometer, bis endlich das erwünschte Ziel in der
Ferne auftauchte. Ganz zum Schluss beschleunigten die Pferde das Tempo
noch einmal, die Wagen fuhren am Dorf entlang, durch das Parktor und
rasselten nach etwa hundert Metern auf das bläuliche Kopfsteinpflaster
der Vorfahrt. Die Kinder sprangen aus dem Wagen, umarmten die
Großmutter, die schon in der Haustür stand, und liefen gleich in
den Pferdestall um ihre Ponys zu begrüßen, die der Großvater aus dem
Krieg mitgebracht hatte.

Bild 8: Drei Brüder Lehndorff hoch zu Ross
Hans
von Lehndorff, der
zweite Sohn von
Gräfin Marie und Graf Siegfried, schrieb in seinen
Jugenderinnerungen (Menschen, Pferde, weites Land): "Das Haus
erweckte eher den Eindruck von etwas Gewachsenem als von etwas Gebautem.
Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es einmal eine Zeit gegeben
hatte, in der es noch nicht da stand. Das lag nicht allein daran, dass
es dicht bewachsen war, vorn mit Efeu und hinten mit wildem Wein -,
sondern die Räume waren so aneinander - und ineinandergefügt wie Leib
und Glieder eines lebendigen Wesens. Jeder Winkel schien mit Leben
gefüllt und strahlte Behaglichkeit aus. Überall hatte man das Gefühl
im lieben Januschau zu sein, dem Ort der vom Geist der Großeltern
geprägt war."

Bild 9: Herbststimmung (Auffahrtseite)
Das hohe zweistöckige Haus mit seinem
Frontspiece und seinen beiden vorgebauten Seitenflügeln betrat man zu
ebener Erde über eine flache Steinstufe. Eine Doppeltür führte in die
Halle, an deren Wänden Jagdtrophäen hingen. Auf der rechten Seite
führte eine breite Holztreppe nach oben, die einmal im rechten Winkel
abknickte. Ihr breites Geländer lud zum Herunterrutschen ein, was nicht
nur von den Kindern praktiziert wurde, sondern auch von manchem
erwachsenen Gast. Auf dem Tisch in der Halle lagen unter anderem
die gewaltigen, mit vielendiger Krone versehenen Abwurfstangen des
stärksten Hirsches der Gegend. Geradeaus führte eine hohe Tür in den
größten Raum des Hauses, den Gartensaal.
Hier stand in der
Mitte ein riesiger rechteckiger Mahagonitisch mit klobigem Fuß, auf dem
eine große Blumenvase in Schalenform, das Gästebuch, Aschenbecher,
Zigarrenabschneider, Brieföffner und ähnliches zu finden waren, und um
ihn herum in weitem Abstand bequeme Polstersessel auf einem großen
Teppich. Von der Decke hingen zwei venezianische Kronleuchter herab.
Links vom Eingang befand sich der Kamin, in den Ecken zwei hohe runde
Kachelöfen in Blau und Weiß, an den Seitenwänden standen alte
Danziger Schränke in dunklen Farben, eine Standuhr, weitere
Sitzgelegenheiten und ein Bechstein - Flügel; darüber hingen mehrere
lebensgroße Familienporträts. Nach rechts und links war der Gartensaal
durch zwei hohe, stets offenstehende Doppeltüren mit den Nebenräumen,
zwei kleineren Wohnzimmern, breit verbunden. Hieran schlossen sich die
Arbeitszimmer der Großeltern.
Links von der Eingangshalle
befand sich das Esszimmer mit drei Fenstern zur Vorfahrt hin, einem
Ausziehtisch für 20 Personen, eichenen Stühlen, holzverkleideten
Wänden und einem riesigen eichenen Büffet an der einen Schmalwand.
Über dem Kamin auf der gegenüberliegenden Seite war folgender Spruch
an die Wand geschrieben:
Mit dem
Schwerte sei dem Feinde gewehrt,
Mit dem Pflug der Erde Frucht
gemehrt.
Frei im Walde grüne seine Lust,
Schlichte Ehre wohn'
in treuer Brust.
Das Geschwätz der Städte soll er fliehn,
Ohne
Not vom eignen Herd nicht ziehn.
So erblüht sein wachsendes
Geschlecht,
Das ist Adels alte Sitt' und Recht.
Hans
Graf von Lehndorff schrieb weiter in seinen Jugenderinnerungen:
"Dieser Raum ist mir im Laufe der Jahre, die ich in Januschau
erlebt habe, der liebste geworden. Ich sehe mich dort sitzen in den
verschiedensten Stadien meines Heranwachsens, als kleinen Jungen neben
meinen Geschwistern, als Halbwüchsigen unter vielen Gästen bei
festlichen Gelegenheiten und schließlich als Erwachsenen zu den
verschiedensten Zeiten des Jahres, wenn das Haus voller Besucher war,
oder auch mit meinen Großeltern allein am Tisch."

Bild 10: Spielende Kinder vor dem Schloss Januschau (Gartenseite)
Wenn die
Enkel am Morgen nach ihrer Ankunft aus dem Hause gingen, standen da
meistens schon ihre gleichaltrigen Freunde aus dem Dorf, Söhne des
Inspektors, des Gärtners, des Schäfers, des Schmiedemeisters, der eingesessenen Landarbeiter, um mit ihnen zu spielen.
Das
entfernteste Ziel, das sie damals mit ihren Pferden anstrebten, war
Schönberg, das Schloss auf dem Wege nach Deutsch-Eylau. Auf der letzten
Strecke wurde ihnen in Erwartung des Zieles schon immer ganz feierlich
zumute. Dann kreuzte der Weg die große Straße, man kam wieder aus dem
Wald heraus und hatte das letzte Wegstück, eine Allee aus abenteuerlich
geformten alten Kiefern, vor sich.

Bild 11: Die Kiefernallee von Schloss Schönberg
Dann sahen sie auch schon die Zinnen des
Schlosses über den Baumkronen. Beim Einreiten in das finstere Burgtor
fühlte man sich um Jahrhunderte zurückversetzt in die Zeit der
Ordensritter, deren Geist hier ganz gegenwärtig war. Innen stand man in
einem allseitig umbauten, von alten Linden überschatteten Hof, etwa 8
Meter über dem eigentlichen Erdniveau.
In den Wohnräumen, die
erst in einer viel späteren Zeit hineingebaut wurden, lebte die Familie
Finckenstein, mit der die Lehndorff''schen Kinder verwandt waren.
Hausfrau war die imposante, baltisch sprechende Tante Irene, ihr Mann,
der eher zarte, sehr freundliche Onkel Conrad. Von der jüngsten Tochter
Mausi (Gabriele) ließen die Kinder sich immer das Schloss zeigen, wobei
sie sich besonders lange an der Klappe aufhielten, durch welche die
Gefangenen in den Turm hinuntergelassen worden waren. Der Pferdestall,
der mit seinen Spitzbogenfenstern eher wie eine Kapelle aussah, zog sie
wegen seiner eigenartigen Lage immer besonders an. Auch das Storchennest
auf dem sogenannten Storchenturm fehlte nicht.

Bild 12: Die Brücke mit dem anschließenden Tor war der einzigste Zugang
zum Schloss Schönberg. Rechts sieht man den Storchenturm.
Auf der
Schlossbrücke holte sich Georg Graf
von Lehndorff seinen ersten Schlüsselbeinbruch. Sein Pony scheute,
rutschte auf dem Pflaster aus und fiel mit ihm hin.
Die
Großeltern waren nach ihrem Äußeren, ihrem Charakter, ihrem
Temperament und ihrer Wesensart völlig verschieden, ja geradezu
entgegengesetzte Naturen.
Der Großvater, korpulent,
lebenssprühend, emotional, schnell reagierend, schlagfertig, immer zu
Späßen aufgelegt, sehr mitteilsam und kontaktfreudig, stets bewegt von
den Ereignissen des Tages in Politik und Wirtschaft.
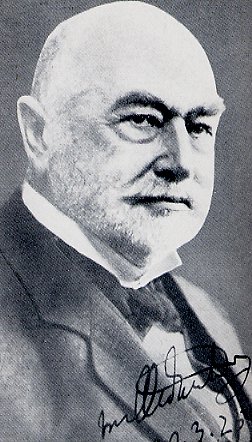
Bild 13: Elard von Oldenburg - Januschau Kammerherr (
20.3.1855 - 15.8.1937)
Oldenburg
war Mitglied des Kreis- und Provinziallandtages und Vorsitzender der
Landwirtschaftskammer Westpreußens in Marienwerder, Mitglied des
Preußischen Abgeordnetenhauses (1901-1910) und Reichstagsabgeordneter der
Deutschnationalen Volkspartei für den Wahlkreis Elbing - Marienburg (1902-1912
und 1930-32). Als bekannter Redner und Freund
vieler einflussreicher Leute lebte er in einer Sphäre, die schon seinen
Enkeln einen Begriff davon gab, welches Maß an Verantwortung für seine
Mitmenschen und für den Staat ein ererbter Besitz, eine preußische
Erziehung und ein heller Verstand auf die Schultern eines Menschen legen
konnten. Bis ins hohe Alter war er ständig unterwegs, meistens zwischen
Januschau und Berlin, oft bei unmöglichen Verkehrsverhältnissen. Für
seine zahlreichen Verdienste um die Provinz wurde er zum Königlich
Preußischen Kammerherrn ernannt.
Als
der Kammerherr einmal mit dem Gedanken spielte, das Parlament zu verlassen,
hielt er auf einer Vertrauensmännerversammlung in Marienburg folgende
Ansprache:" Holt Euch endlich einen anderen Schafskopf, der Frau
und Kinder, Haus und Wirtschaft verlässt, um leeres Stroh zu dreschen.
Ich passe gar nicht in das Parlament. Wie viele Ferkel eine Sau in
Januschau bekommt, interessiert mich mehr, als die geistreichste Rede
des Abgeordneten Richter."
Diese kernigen Worte druckte das
freisinnige Parteiblatt ab und machte dazu die Bemerkung: "Eines
Kommentars bedarf es nicht. Wo ist das nächste westpreußische
Irrenhaus?"
Als
es im Reichstag immer wieder um die Abschaffung der Kommandogewalt des
Kaisers über das Heer ging, war es stets der Kammerherr, der sich
widersetzte. So antwortete er dem freisinnigen Abgeordneten
Müller-Meiningen auf seine gegen die kaiserliche Kommandogewalt gerichtete
Rede kurz und drastisch wie immer: "Der König von Preußen und der
Deutsche Kaiser muss in jedem Moment imstande sein, zu einem Leutnant zu
sagen: Nehmen Sie zehn Mann und schließen Sie den Reichstag!" Die
Oldenburg' sche Rede sorgte für tumultartige Szenen im Parlament und für
einen Sturm der Entrüstung in der politisch andersgerichteten Presse.
Nach
Ausbruch des 1. Weltkriegs wurde er zuerst Verbindungsoffizier der V. Armee
zum Hauptquartier, dann erhielt er eine Order als Ordonnanzoffizier beim
Stab des 17. Armeekorps, das unter Mackensen bei Warschau und Lodz focht.
Hier feierte er im März 1915 seinen 60. Geburtstag, an welchem
er zum Major befördert wurde. 1916 wurde er Kommandeur des Staffelstabes
bei der 86. Division und übernahm später die Führung des IR. 341. 1917
nahm er seinen Abschied und engagierte sich im heimischen Bund der
Landwirte.
Teil
2 oder Index |