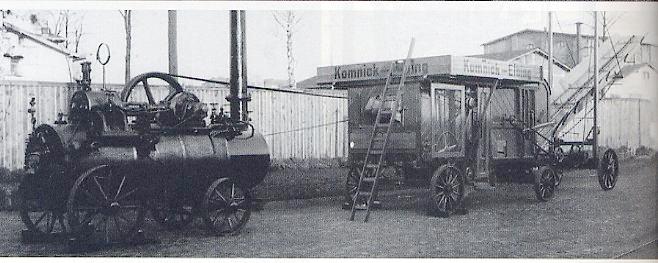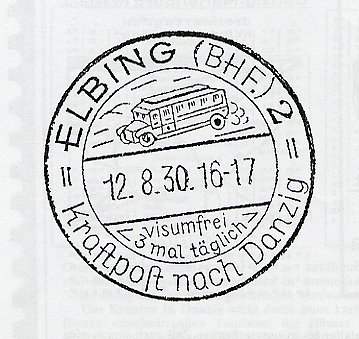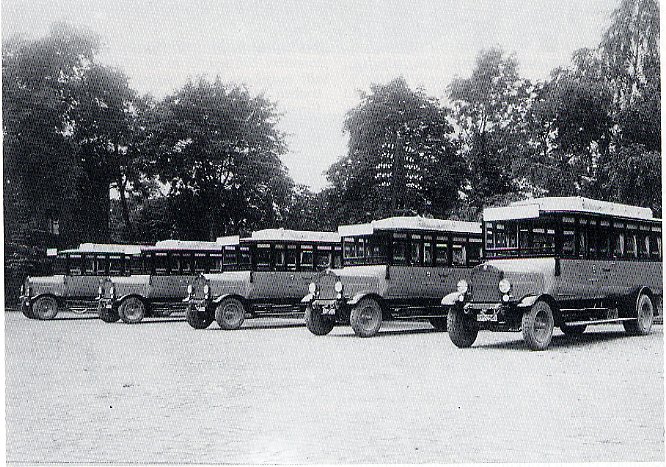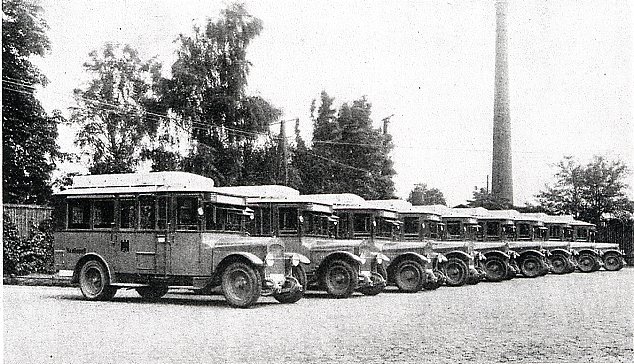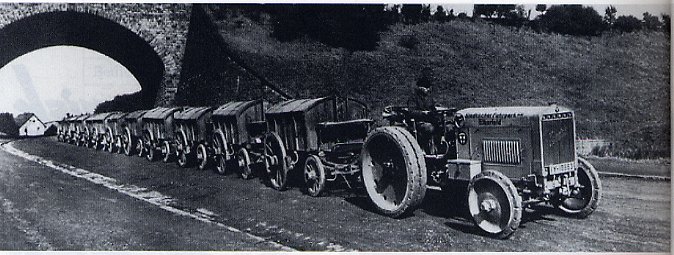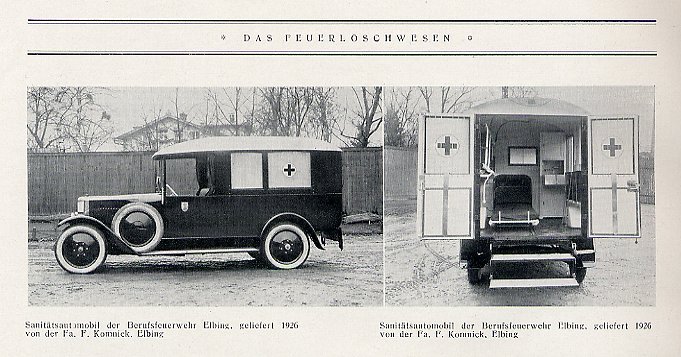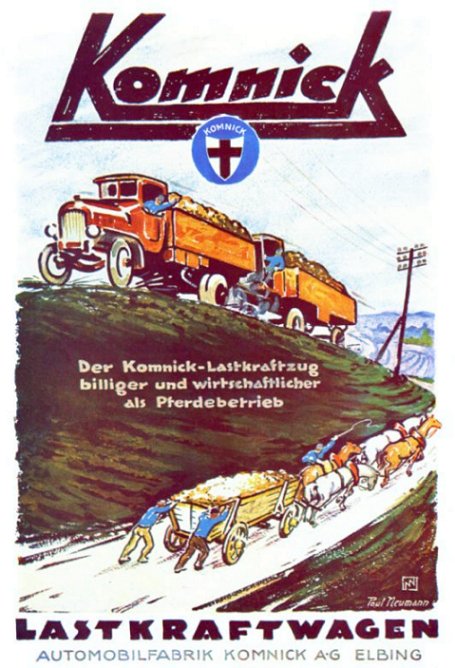|
3. Teil: Nachkriegszeit 1918 - 1926
Man schrieb das Jahr 1918, der Krieg war zu Ende. Wie überall, so lag
auch Elbings Industrie und Wirtschaft am Boden. Besonders die Schichauwerft und
die Lokomotivenfabrik, die Zigarrenfabrik Loeser & Wolff und auch die
Automobilfabrik F. Komnick, waren vom Niedergang der Wirtschaft hart betroffen.
Von einem Tag zum anderen mußten sich die Betriebe auf die seit 4 1/2 Jahren
ungewohnte Friedenswirtschaft umstellen. Die friedensmäßige Entwicklung konnte
aber wegen des katastrophalen Kohlenmangels, der gleichzeitig auch eine starke
Lahmlegung und zeitweise sogar den völligen Stillstand des Eisenbahnverkehrs
bedeutete, nicht recht anlaufen. Der Absatz stockte. An die Industrie traten
aber, infolge der Steigerung aller Löhne und Gehälter, erhebliche finanzielle
Anforderungen heran . 7 Millionen Arbeitslose gab es in Deutschland und überall bemühte man sich,
langsam wieder aufzubauen und bessere Wirtschaftsverhältnisse zu schaffen.
Andere
Erschwernisse machten sich bemerkbar. So stiegen die Frachtkosten der
Firma Komnick nach dem Krieg auf das Doppelte.
Früher
hatte die Elbinger Eisenindustrie sehr brauchbare Arbeitskräfte aus dem
Danziger Werder und aus dem Memelgebiet an sich gezogen. Durch die
Abtrennung dieser Landesteile als Folge des Versailler Vertrages fiel von
jetzt an dieser gute Ersatz vollständig aus. Wegen der Entwicklung der politischen
Verhältnisse nach dem Krieg
schien ein Verkauf des Danziger Eisenwalzwerkes (frühere Gößlersche
Gründungen), das sich ebenfalls im Besitz von Franz Komnick befand, ratsam zu
sein. Einige der Hallen waren vorher nach Elbing überführt
worden.
Trotz all dieser
Schwierigkeiten mußte unbedingt für Absatz gesorgt werden, um die
Belegschaft zu halten, die damals etwa 2400 Köpfe zählte. Das war aber
gar nicht so einfach, weil nach dem Kriege die Staatsaufträge für
Kriegszwecke zu Ende waren.
Franz Komnick fand auch hier einen neuen
Ausweg, um wenigstens zeitweise über die Schwierigkeiten hinweg zu
kommen. Der neu gebildete Staat Litauen hatte zum Aufbau seines
Verkehrswesens unter anderem einige Dutzend deutscher Lokomotiven
erhalten, die aber durch den Krieg stark abgenutzt waren. Verhandlungen
mit Kowno führten zum Ziel, und so wurden der Automobilfabrik die meisten
dieser Lokomotiven zur Überholung überwiesen. Oftmals wurde durch das
Anfertigen von neuen kupfernen Feuerbuchsen, usw. eine Vollreparatur
vorgenommen.
Nach dem Ersten Weltkrieg wollte Franz Komnick
das Gelände des großen militärischen Flugplatzes (350 000 m²) mit seinen modernen
Hallen und Gebäuden erwerben. Nach dem Versailler Diktat mußten
auf allen Flugplätzen des Deutschen Reiches aber sämtliche Anlagen durch
Sprengung restlos vernichtet werden, so natürlich auch in Elbing. Nach
schwierigen Verhandlungen gelang es Komnick mit Zustimmung
der Interalliierten Kontroll - Kommission das Gelände mit den Hallen zu
erwerben und die Hallen vor der Sprengung zu bewahren. Es wurde
nur eine kleine Sprengung "pro
forma" vorgenommen, die keinen großen Schaden anrichtete.
Auf dem
Flughafengelände wurden dann zuerst landwirtschaftliche Maschinen, Dampfmaschinen und Rohölmotoren gefertigt.
Sowohl von den Dampfpflügen, als auch von den Motorpflügen mußte eine
größere Anzahl nach dem Ersten Weltkrieg für die Waffenstillstands - Kommission
geliefert werden.
Wie
beliebt die Komnick - Motorpflüge in überseeischen Ländern waren, mag daraus zu
ersehen sein, daß schon kurze Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wieder ein Komnick
die Reise nach dem fernen Argentinien antrat.
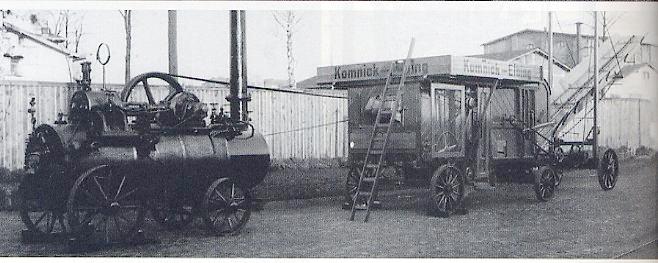
Bild 34: Verfahrbare Komnick - Dampfmaschine mit Komnick -
Breitdreschmaschine und Förderband.
Im Frühjahr 1922 wurde die Automobilfabrik in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Kommerzienrat Dr.-Ing. eh.
Komnick hielt 3/5 des Kapitals in Familienbesitz und wurde alleiniger Vorstand.
Mit dem Gang an die Börse wollte man Kapital für die Modernisierung des
Betriebes gewinnen.
In den 20er Jahren standen erst noch Pferdedroschken auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz
und in der Friedrichstraße am Rathaus. Sie mußten aber bald den Auto-Taxen der
Fuhrunternehmen Ing. Nocon und Traugott Damerau weichen. Sie hatten Mercedes, NAG und
Protos - Wagen. Herr Renters (Fahrräder und Nähmaschinen am Alten Markt nahe des
Markttors) fuhr einen Wanderer-Wagen mit zwei hintereinanderliegenden
Sitzen.
Der Elbinger Ewald Passenheim berichtet über seine ersten
Erfahrungen als Fahranfänger im Jahre 1927: "Anno dazumal hatten die Wagen noch die Steuerung rechts. Man
saß rechts und Schalt- und Bremshebel waren außen am Wagen angebracht. Doch
ehe man zum Fahren kam, mußte man - wie heute - den Führerschein
erwerben. Dazu war das Alter von 18 Jahren Voraussetzung. Beim Kreisarzt
bekam man gegen eine Gebühr ein Tauglichkeitsattest ausgestellt, mit dem man
sich zum Unterricht anmelden konnte. Einer der Elbinger Fahrlehrer war damals der
Mechanikermeister Johannes Urbanski, der eine Motor- und Fahrradhandlung in der
Heiligen Geist-Straße hatte. Prüfer war Ober - Ing. Kruchen vom
Dampfkesselüberwachungsverein. Bei der Führerscheinprüfung mußte man 5
Fragen beantworten.
Am Lenkrad waren damals 3 Hebel: der Gashebel, der
Lufthebel und der Zündungshebel. Nun hieß es den Motor anlassen. Das geschah
durch die Kurbel vorne am Motor. Gashebel, Luft und Zündung durften nicht zu
stark eingestellt werden, da sonst die Kurbel bei zu starker Frühzündung
zurückschlagen konnte. Dabei hat sich schon mancher den Unterarm gebrochen. Die
bequemen Anlasser, wie wir sie heute kennen, gab es erst viel später. Sobald
der Motor lief, ging die Fahrt los. Bei jedem Hindernis mußte man hupen. Das
erfolgte durch eine von Hand betätigte Ballhupe. Die Richtung, die man
einschlagen wollte, wurde durch einen herausgestreckten Arm und später durch
Winker, die an den beiden Seiten der Türe angebracht waren, angezeigt. Die
Fußgänger auf den Straßen Elbings schimpften, wenn ein Auto oder gar ein
Motorrad vorüberfuhr und auch die Polizisten, die an wichtigen Kreuzungen
standen, beobachteten argwöhnisch das Verhalten der Vehikel.
1921/22 gab es in Elbing noch keine
Tankstellen. Wer Benzin brauchte, fuhr zu einer Benzin-, Öl- und Fettehandlung oder zu einer Drogerie. Das Benzin wurde
mit einer Faßpumpe aus Weißblech aus dem Faß in eine Meßkanne gepumpt und in
den Fahrzeugtank eingefüllt. Dann fuhr man davon. Als später Aral, BP und
Shell die ersten Tankstellen bauten, war es einfacher. Man verlangte 20 Liter
oder den Tank voll.
Traditionsgemäß fiel ein hoher Exportanteil der Maschinen- und der
Automobilfabrik auf Rußland, sogar noch fünf Jahre nach der russischen
Oktoberrevolution. Mit der Einführung der Rentenmark im Spätherbst 1923 kam
nach den unerträglichen Schwankungen der Inflation das Wirtschaftsleben
wieder in geregelte Bahnen. An Aufträgen fehlte es den beiden Fabriken
kaum. Auch Behörden und Wehrmacht wurden in steigendem Maße zu
Abnehmern.
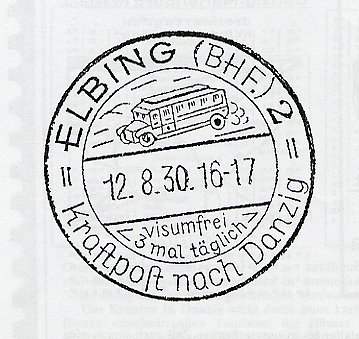
Bild 35: Vergrößerung eines Kraftpoststempels
Reichspost, Schutzpolizei und andere Behörden bestellten
die Komnick - Lastwagen, Mannschaftswagen und Busse.
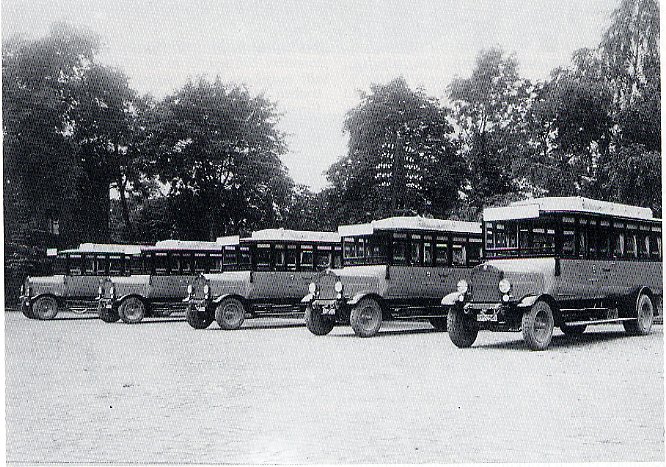
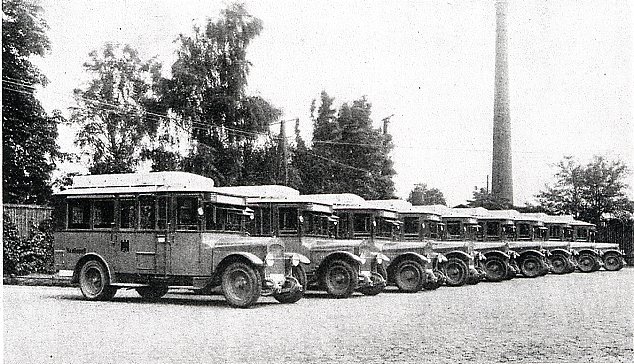
Bild 36 + 37: Komnick - Autobusse für die Reichspost
Die Reichswehr kaufte mehrmals 50 - 100 Fahrzeuge. Ebenso wurden Autobusse
und Schlepper an die Städtischen Verkehrsbetriebe von Königsberg und Gumbinnen
geliefert. Mit den von Komnick gebauten Omnibussen fuhren Post und
Privatunternehmen Tausende von Kilometern. Zunächst sah man Lastwagen mit
Vollgummireifen, wie sie auch die Brauerei Englisch Brunnen hatte. Sie rollten
durch die Straßen, daß die Fenster der Häuser zitterten. Bald wurden die
Fahrzeuge mit Luftreifen bestückt. Sie rollten nun leichter und federnder und
die Geschwindigkeit wurde schneller. Postbusse fuhren von Elbing nach Danzig
über Einlage an der Nogat und bei Neumünsterberg über die Weichsel. Die Fahrt
dauerte damals 2 1/2 Stunden, weil die Motoren auf 30 Stundenkilometer
gedrosselt waren. Doch nicht nur die Post, sondern auch Privatunternehmen wie
Herr Hartmann, befuhren die Strecke. Trotzdem waren die Plätze oftmals knapp,
so daß mancher auf dem Dach sitzen mußte. Die Abfahrt erfolgte in der
Wilhelmstraße vor dem Hotel Rauch.
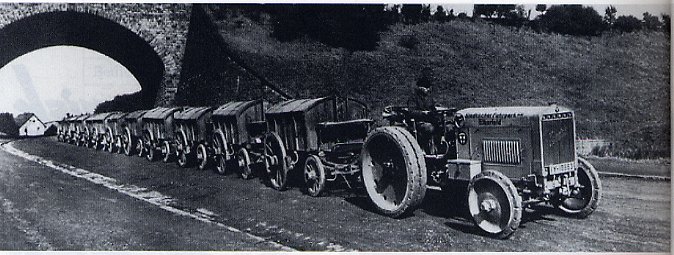
Bild
38:
Komnick - Großschlepper zieht 12 beladene Müllwagen der Stadtverwaltung
Elberfeld. (Werbepostkarte)
Komnick baute u. a. auch Krankenwagen, beschränkte sich aber
mehr und mehr auf die Herstellung schwerer Fahrzeuge und spezialisierte sich ab
1927 auf LKW und ähnliche Wagen.
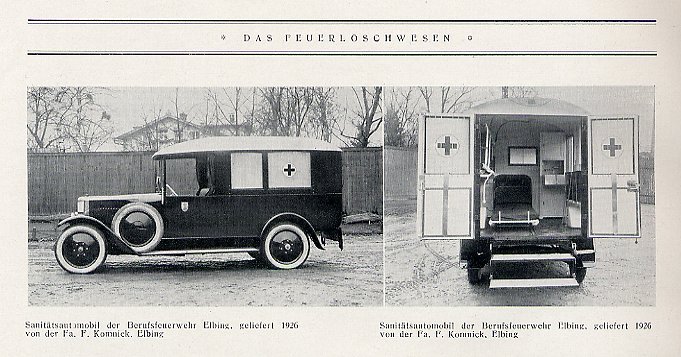
Bild 39:
Sanitätsautomobil für die Berufsfeuerwehr Elbing aus dem Jahr 1926.
Anläßlich des 25-jährigen Bestehens der Maschinenfabrik (1923) und als
"Anerkennung für seine Dienste um den technischen Fortschritt und die
Entwicklung der Industrie im Osten" erhielt Franz Komnick von der
Technischen Hochschule in Danzig den Titel "Ehrendoktor"
(Dr.-Ing. eh.).
Zum großen Leidwesen Franz Komnicks hatte sich sein
Tragpflug (Motor und Pflug in einem Körper), auf den er große Stücke
hielt, nicht durchgesetzt. Er wurde fast vollständig durch den in den
Vereinigten Staaten schon lange entwickelten, vielseitig verwendbaren
Schlepper verdrängt, der durch einen angehängten Pflug zum
Ackerschlepper gemacht werden konnte. Auf Grund der Ergebnisse einiger großer
Leistungsprüfungen entschloß sich F. Komnick nunmehr auf Anraten
staatlicher Stellen zum Bau von Straßen- und Ackerschleppern in
Zusammenarbeit mit der Bau- und Vertriebsgemeinschaft Benz-Sendling,
München. Er baute seine Schlepper-Fahrgestelle, deren Stärke
sich stets besonders bewährt hatte, und Benz-Sendling lieferte aus seinem
süddeutschen Werk für den Ackerschlepper seinen Dieselmotor. Die Verwendung des billigen Diesel-Kraftstoffes verbilligte die
Betriebskosten erheblich. Als Markenzeichen verwendete Komnick das von
seinen Fahrzeugen bekannte Schild des Deutschen Ordens in einem runden
blauen Feld. Über dem Ordenswappen befand sich in einem Halbrund der Name
"Komnick".
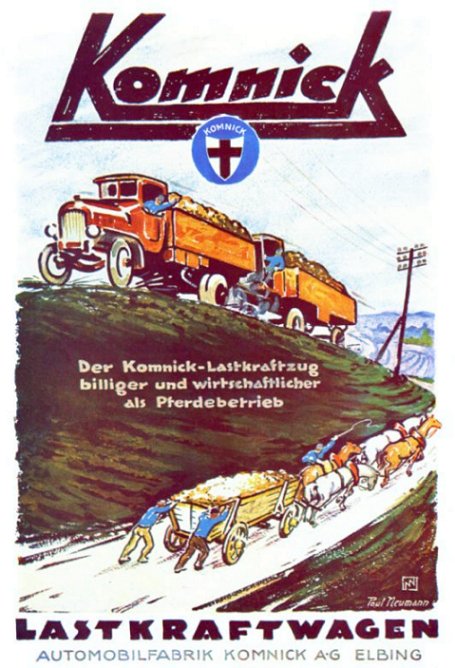
Bild
40: alte Komnickreklame
Im Jahre 1926 waren in den Komnickwerken ca. 5000 Menschen beschäftigt (siehe
Lockemann, DARI-V. 1926).
4. Teil oder Index
12.05.05 -b-
|