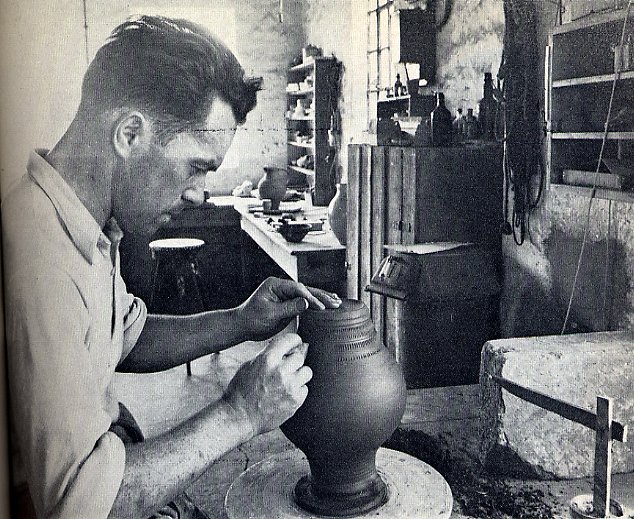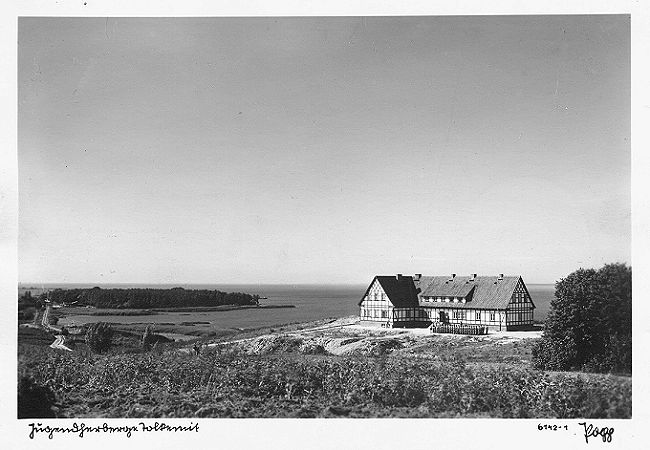Tolkemit - Tolkmicko - Teil 2 a)
Töpfereien
Tolkemit ist von alters her als "Töpferstadt"
bekannt. Spuren ältester Töpferei in diesem Raum gehen zurück bis in
die Jungsteinzeit: Noch im 19. Jahrhundert war die Töpferei in
Tolkemit ein blühendes Gewerbe. Um 1860 bestanden in Tolkemit 41
Töpfereien,
in denen außer 41 Meistern, 21 Gehilfen und neun Lehrlinge arbeiteten.
Aber dann ging ihre Zahl allmählich zurück. Vor dem 1. Weltkriege
bestanden noch etwa 15 Töpfereien, die bis auf vier nach dem Kriege
eingegangen waren. Von diesen blieb schließlich nur die Töpferei Seeger
in der Frauenburger Straße bestehen. Ein Grund für den Niedergang des Töpfergewerbes war, dass die Bauern
zum Emaillegeschirr übergingen und die Zentrifuge die großen flachen
Milchschüsseln überflüssig machte. Um die Jahrhundertwende
lebte in Tolkemit der Töpfermeister Andreas Zimmermann, ein Nachfahre der
vielen Meister ihres Faches, die diesen Namen trugen. Er hatte in Bunzlau
die Fachschule besucht und gründete in seinem Heimatstädtchen eine
Kunsttöpferei. Auf Empfehlung von Gewerbeoberlehrer Bermwoldt aus Elbing,
stellte er zwei junge Kunstmaler ein, die Brüder Gustav und Franz
Liedtke. Sie verzierten alles, was Herr Zimmermann auf der Töpferscheibe
herstellte. Er war der Meister der Formen und ließ den Malern große
Entfaltungsmöglichkeit.
Bild
23: Töpfermeister Andreas Zimmermann war der letzte Kunsttöpfer von
Tolkemit (Turmstraße). Später arbeitete er, wie viele andere
der absatzberaubten Tolkemiter Töpfer, für die von Kaiser Wilhelm II.
1904 gegründete Cadiner
Majolikawerkstätte. Gustav und Franz Liedtke begleiteten ihn nach
Cadinen. Nach seiner Tätigkeit als Töpfermeister in der
Majolika-Werkstatt widmete sich Andreas Zimmermann noch dem Beruf eines
Haffschiffers. Er befuhr mit seinem eigenen Kurenkahn das Haff und die
angrenzenden Schifffahrtswege. Wie eine ganze Reihe Bewohner der
Stadt Tolkemit, fand er am 7. Februar 1945 im Alter von 73 Jahren zusammen
mit seiner Frau, die er noch vor einer Schändung beschützen wollte,
durch Gewehrkolben der Russen seinen Tod. Über die Arbeit in den Tolkemiter Töpfereien
Die Tolkemiter Töpfer holten im Winter ihren Ton bevorzugt aus dem beim
Wieker Berg gelegenen Holm und sonst auch aus den Bergen. Der Ton wurde
zum Durchfrieren ausgebreitet. Danach wurde er mit den Füßen geknetet,
auf einem festen Tisch durchgeschlagen und dabei mit Sand auf
Feuerfestigkeit und Plastizität gemagert.
Die Töpfer fertigten: Kochtöpfe, Kaffeetöpfe, Milchtöpfe
mit Schnauzen, die gleich nach dem Drehen zwischen den Fingern
eingezogen und im lederharten Zustand gehenkelt wurden. Außerdem wurden
Schmalztöpfe, Pökeltöpfe, Milchschüsseln, Waschschüsseln und
Blumentöpfe in allen Größen serienweise hergestellt und alles aus
freier Hand gedreht. Das Geschirr trocknete an der Sonne, die ihm einen
schönen Farbton verlieh. Die meisten Töpfer fertigten auch Ofenkacheln
und setzten Kachelöfen. Alte Original Art Deco Vase der Kunsttöpferei Tolkemiter
Erde (Inhaber August Caspritz), Montierung 800er Silber. Am Boden
Firmenstempel mit Pressmarke (1935-45): Tolkemiter Erde mit
Dreiblatt-Eiche im Wappen - Ostdeutsche Handarbeit - 4046. Die
Silbermarke Mond/Krone / 800 / HB im Wappen (mit Krone/Zinnen) stammt von
Hermann Bauer , Schwäbisch Gmünd , (gegr.1863 - heute).
Das Geschirr wurde im getrockneten Zustand mit einer Masse aus leicht
schmelzendem Ton und Bleimennige glasiert, die mittels eines Blasrohrs
aufgesprüht wurde. In alter Zeit wurde nur eine Salzglasur aufgebrannt.
Die Brennöfen waren teilweise in den Berghängen eingebaut. Das
Geschirr wurde im Holzfeuer bei etwa 700 Grad gebrannt und im einmaligen
Brand fertiggestellt. Im Brennofen befanden sich Löcher zum
Probenziehen. An den Proben stellte der Töpfer fest, wie weit der Brand
vorgeschritten war. Das fertige Geschirr wurde in ein Schiff verladen.
Der Schiffer suchte mit seiner Fracht eine Stadt auf, die für ihn in günstiger
Windrichtung lag. Dort wurde die Ware auf dem Markt verkauft.
Das Tolkemiter "Erlenwäldchen" lag, ganz grob
gesagt, an der Mündung des im Mittelalter um die Stadt geleiteten Baches
oder auch Schulbach genannt, ins Frische Haff. Genau geschrieben, handelte
es sich um ein Wäldchen von der Größe einiger Morgen. Begrenzt wurde es
vom Haff, dem Gleiskörper der Haffuferbahn, der Schiffswerft, den
Sägewerken (Modersitzki und Lingner), dem Aufschlepp- und
Netztrockenplatz und dem Hafen. Der Bewuchs des Wäldchens bestand
überwiegend aus Erlenbäumen und so wurde es von den Tolkemitern als ihr
"Erlenwäldchen" bezeichnet. An der Hafenausfahrt lag zur rechten Hand der bei den
Tolkemitern und auch bei den Touristen beliebte Hafenkrug von Erwin
Dossow am Erlenwäldchen (Bild 28).
Dort wurde das bekannte Englisch-Brunnen-Bier
aus Elbing ausgeschenkt und wer wollte, konnte sich mit einem "Weißen"
oder einem Bärenfang stärken. Der Erlenkrug war Restaurant und Hotel.
Von einer großen Veranda sah der Gast über das Frische Haff zum großen
Leuchtturm, dem "Ponitz", und nach Kahlberg.
Aber auch von der Frischen Nehrung war der Hafenkrug
und das dahinterliegende Erlenwäldchen zu erkennen. Im Sommer luden außerdem
die auf der Haffseite vor der Veranda im Freien aufgestellten Tische und
Stühle zu Kaffee und Kuchen ein und die beliebte Küche z.B. mit
Fischgerichten, wie dem "Aal in Dill". Diese Aufnahme wurde
etwa 1939 gemacht.
 Bild 31: Blick von der Terrasse des Hafenkrugs auf die Hafeneinfahrt  Bild 32: Links sieht man den Hafenkrug mit Terrasse und rechts den Kahlbergdampfer "Tolkemit". Mit ihm fuhr man in 35 Minuten vom Tolkemiter Hafen nach Kahlberg. Er ist ein Nachkomme jenes ersten Raddampfers mit dem Namen "Schwalbe", den das "Dampfboot-Konsortium" von fünf Elbinger Kaufleuten 1840 bauen ließ. Damals begann die Blüte des Ostseebades Kahlberg.
Bild 35: Blick auf die Jugendherberge am Galgenberg und auf das
Frische Haff Bild 36: Die Jugendherberge in Tolkemit in Großaufnahme Copyright Christa Mühleisen |