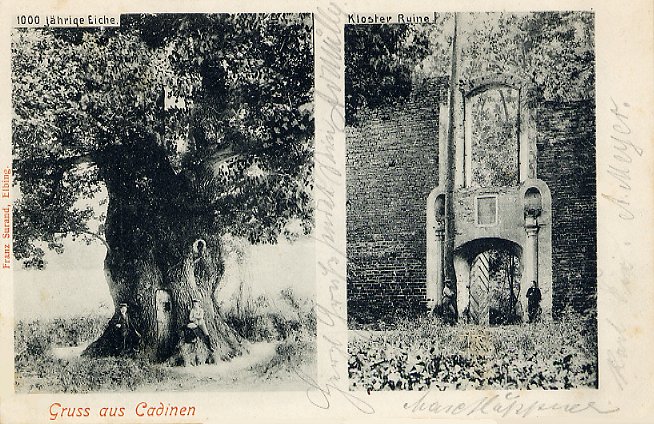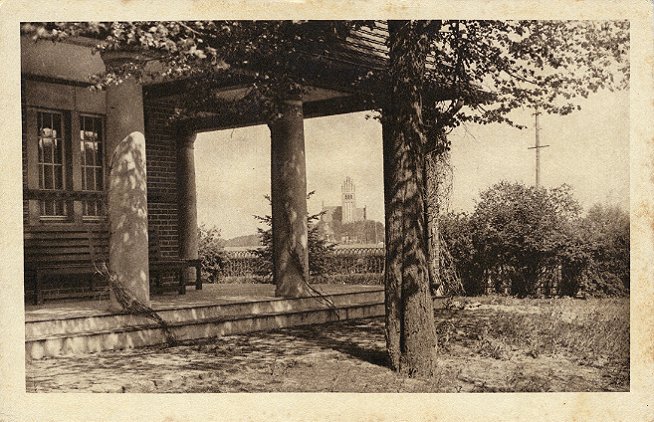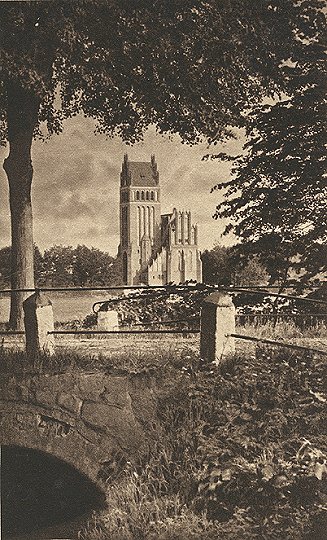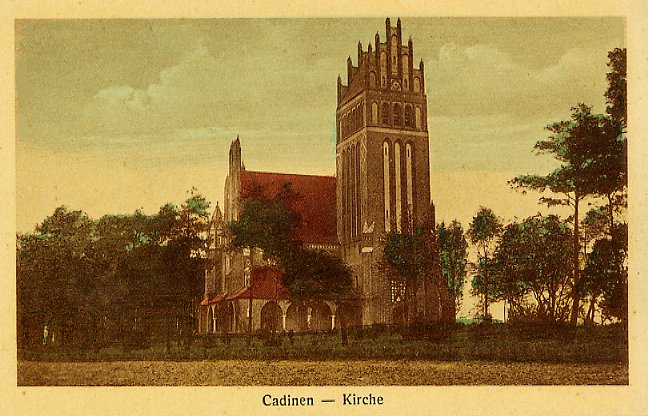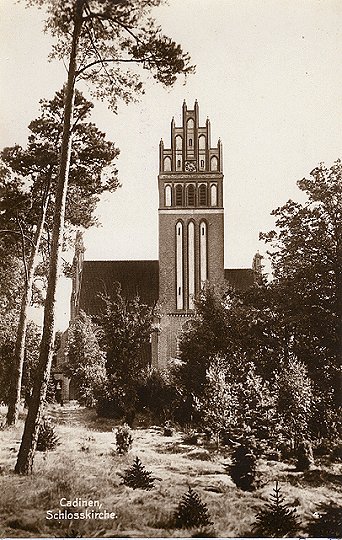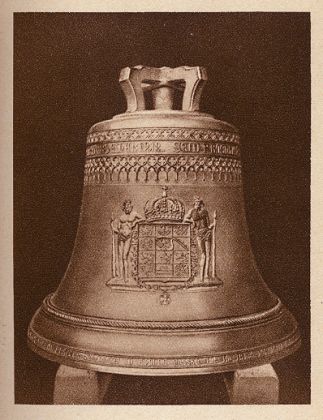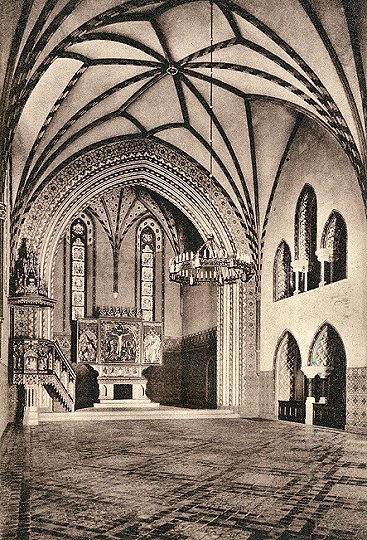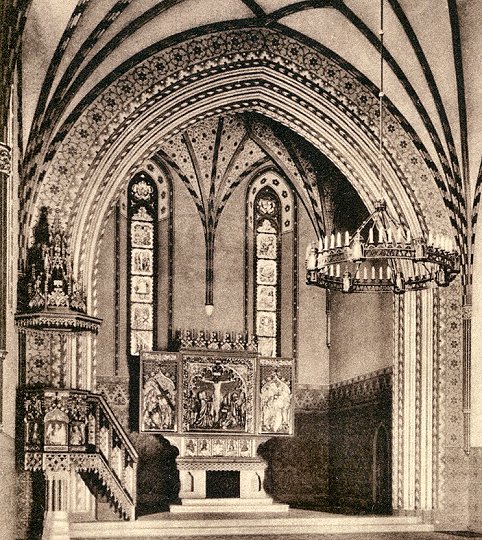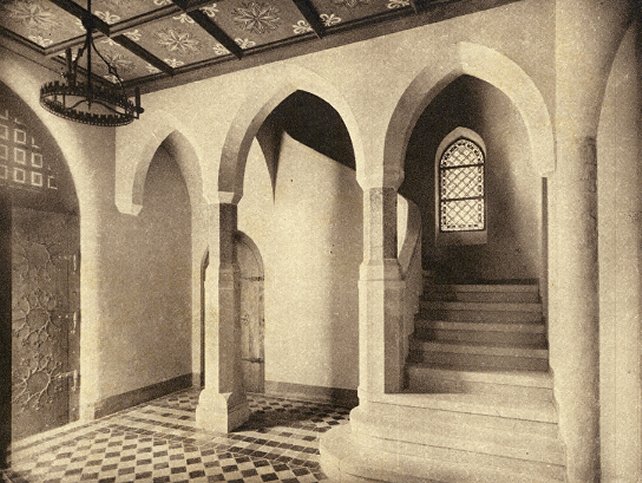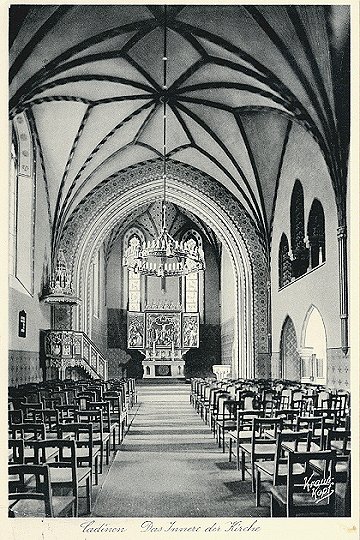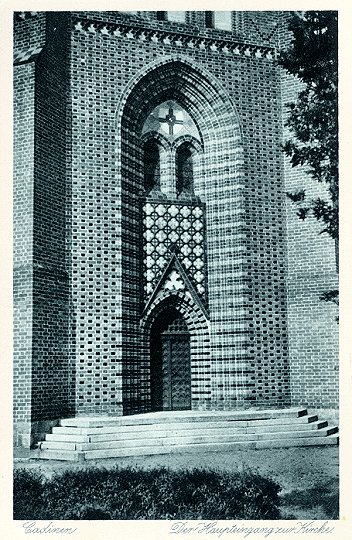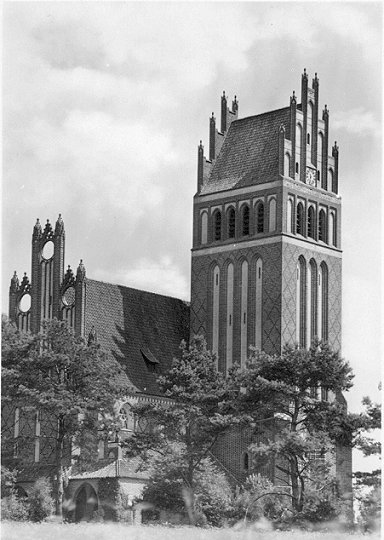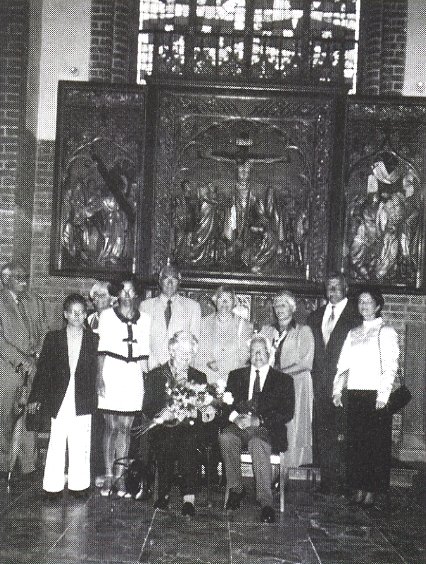|
Cadinen -Teil
4
Die Cadiner Kirche

Bild
70: Blick
auf Cadinen
Anmutig
zwischen dem Frischen Haff und einem Kranze reich bewaldeter Höhen
liegt, umgeben von weiten Wiesenflächen und wogenden Kornfeldern, die
Kaiserliche Herrschaft Cadinen. Ihr alter schöner Park mit malerischer
Klosterruine und die nahen Wälder mit vielhundertjährigem Eichen- und
Buchenbestand bildeten von jeher ein beliebtes Ausflugsziel der Elbinger
und Königsberger.
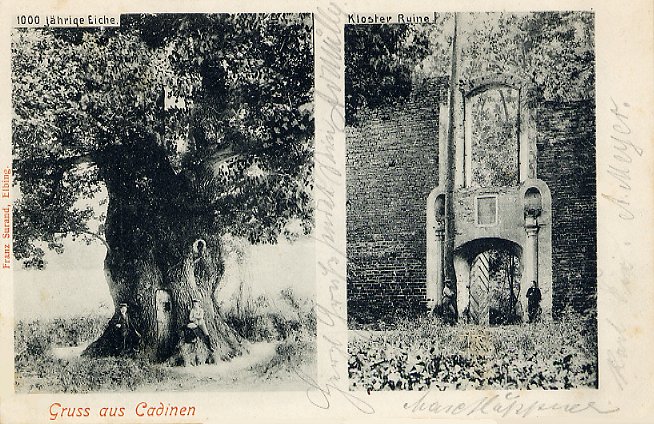
Bild
71: Links
sieht man die 1000 jährige Eiche und rechts einen Teil der Klosterruine
(8.4.1901)
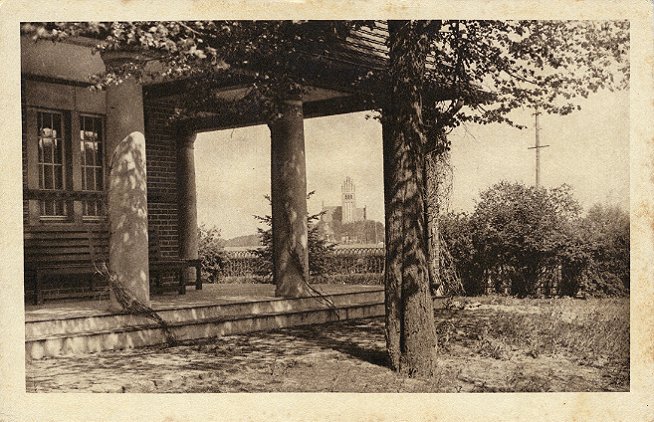
Bild
72: Alte
Kupfertiefdruckkarte mit einem Durchblick auf die Kirche (Willibald
Zehr, Elbing)
Stattliche Wirtschaftsgebäude und weinumrankte
Beamten- und Arbeiterwohnhäuser schauten mit ihren roten Pfannendächern
freundlich aus dem Grün der Gärten und boten, gehegt und gepflegt
durch stete wachsame Fürsorge des Kaiserlichen Gutsherrn ein
anziehendes Bild eines vornehmen westpreußischen Herrensitzes.

Bild
73: Blick auf die Kirche
Einige
Jahre später ist es durch eine stattliche Kirche vervollständigt
worden, welche durch ihre etwas erhöhte Lage auf einem vom Hohen
Bauherren selbst ausgewählten, in einiger Entfernung vom Dorfe am Rande
eines Kieferngehölzes gelegenen Platze die Umgebung eindrucksvoll
beherrschte und ein charakteristisches Wahrzeichen der malerischen
Haffküste zwischen Elbing und Frauenburg bildete.
Beim nächsten Bild handelt es sich
um eine Architekturzeichnung zur Vorlage beim Kaiser, mit interessanten
Bildunterschriften:

Bild 74: Winter in Cadinen

Bild
75: Vergrößerung der Unterschriften von obiger Architekturzeichnung. Genehmigt 9/X
1912 W i l h e l m
Kickton
Bildrückseite: Gehört zur Kirche in Cadinen
Geh. Regierungsrat und Baurath Kickton Posen, Hardenberg Nr.
8
Hu. D. 2296 Lfd. Nr. 125 Originalgröße (ohne
Rahmen) 21 x 27 cm, Foto: R. Wolf 05.08.1990.
(Haus Doorn)
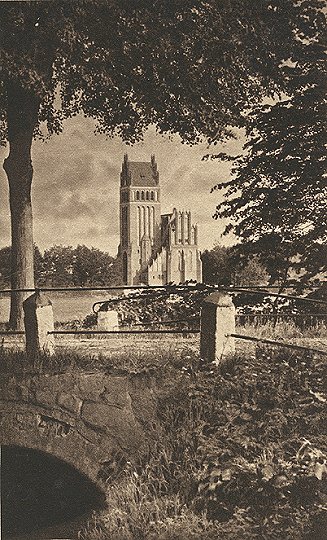
Bild
76: Kupfertiefdruck-Karte
( 5.8.1919) von Willibald Zehr, Elbing Zur
Grundsteinlegung war der Kaiser extra angereist, da die Kirche für ihn
sehr wichtig war. Die
nach den Plänen und unter der Oberleitung des Geheimen Baurats Kickton
in Berlin im Jahre 1913 begonnene Ausführung des Bauwerks konnte trotz
der ungünstigen Zeitverhältnisse im Frühjahr 1916 zum Abschluss
gebracht werden. Nach den Wünschen des allerhöchsten Bauherrn ist die
Kirche im Charakter der heimischen Ordensbaukunst als reicher
Backsteinbau gestaltet worden, deren bezeichnende Merkmale sie zeigte:
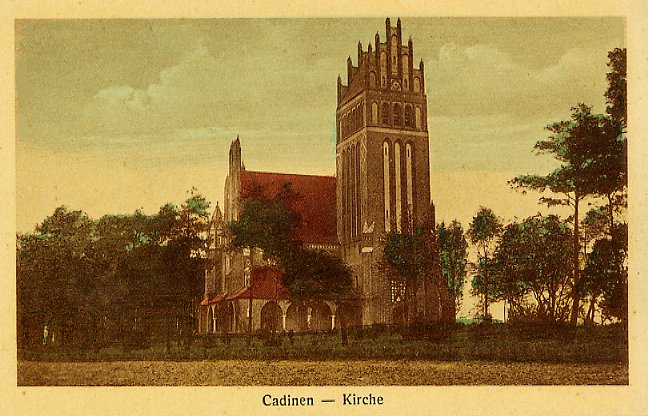
Bild
77
Geschlossene,
die Umgebung beherrschende Masse, wuchtiger Turm, straffe Gliederungen,
wirkungsvoll verteilter Fries- und Blendenschmuck, Verwendung glasierter
Steine in wechselnden Mustern zur Belebung der Flächen, zierliches
Fenstermaßwerk in tief eingeschnittenen geputzten Leibungen; im Innern
reiche aus schlanken Diensten sich entwickelnde Gewölbe mit fein
profiliertem Rippenwerk und zierlichen Einzelheiten an Kapitälen und
Kragsteinen.
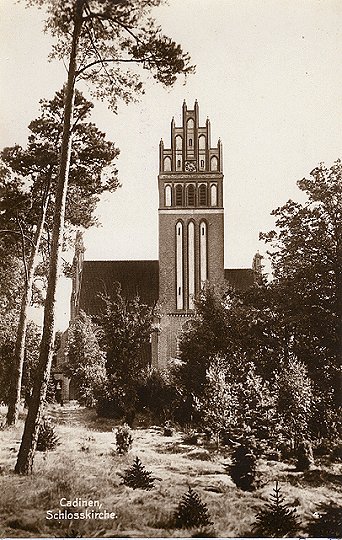
Bild 78
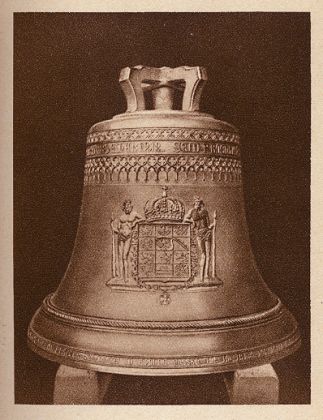
Bild 79: Die Cadiner GlockeDie
große Glocke der Kirche
des Kaiserlichen Gutes in Cadinen -Ton c, Gewicht 2700 kg -, wurde von der Hofglockengießerei Franz Schilling Söhne in Apolda (Thüringen)
hergestellt.
Die Abbildung (Postkarte) stammt aus einem Buch, das zum 100-jährigen
Bestehen der Hofglockengießerei im Jahr 1926 herausgegeben
wurde. Franz Schilling Söhne in Apolda lieferten von 1826-1926
über 10 000 große Kirchenglocken aus Bronze in alle Welt. Darunter
befinden sich die bedeutendsten Geläute Deutschlands. Sie gossen u. a.
auch die Glocken der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin.
Die
Grundrissanordnung ergab sich zwanglos aus der Lage der Kirche zum Dorf.
An ein dreijochiges Langschiff, dem sich ein, Taufkapelle und Vorhalle
enthaltendes niedriges Seitenschiff sowie der die Logen für die
Majestäten und das Gefolge enthaltende Turm angliederten, schloss sich
östlich der flachgeschlossene Altarraum mit Sakristei an.
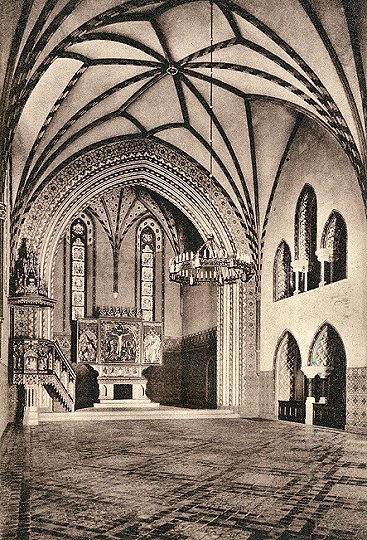
Bild
80: Sommer
1922, Kupfertiefdruck-Karte von Willibald Zehr, Elbing.
Rechts sieht
man die Logen für die Majestäten und das Gefolge.
In
diese Kirche kam außer schmückendes Majolika auch ein prächtiger
neogotischer Altar. Er ist ein ganz besonderes Kunstwerk. Der
aufgeklappte linke Altarflügel zeigt die Kreuzabnahme und der rechte
Flügel, wie Jesus am Kreuz die Mutter tröstet. Es handelt sich um
einen Schnitzaltar wie aus Dürers Zeiten.
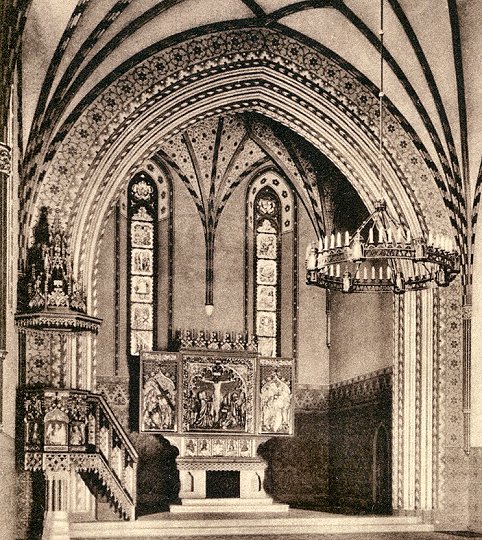
Bild
81: Ausschnitt
aus obiger Ansichtskarte

Bild
82: Blick
auf die Orgel (Willibald Zehr Elbing)
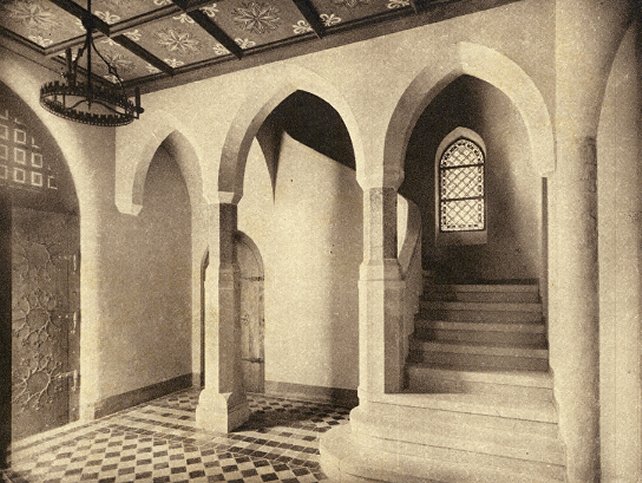
Bild
83: Treppenaufgang
und verzierte Kassettendecke mit Kerzenleuchter (Willibald Zehr, Elbing)
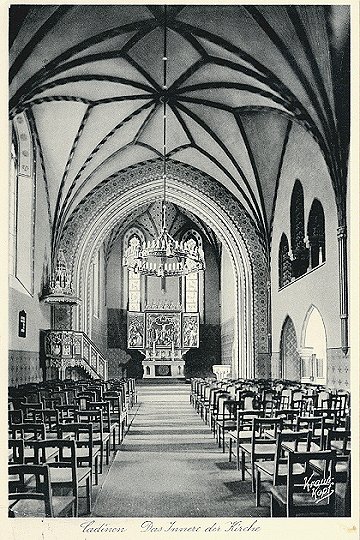
Bild
84: Blick
zum Altar mit bestuhltem Innenraum (1942)
Den Abschluss gegen das umgebende Gelände bildete eine aus Granitfindlingen
hergestellte Futtermauer mit Plattform, die einen weiten Rundblick auf
das Haff und die umgebenden Höhen bot. Die
Umfassungsmauern der Kirche sind aus Steinen großen Formats mit
kräftiger Fugung hergestellt und mit schwarz glasierten Köpfen
gemustert worden, die Portale wurden mit gelb und grün glasierten, die Giebel mit
schwarz glasierten Schichten durchsetzt. Besonders reichen Schmuck hatte
die Nische über dem zu den Logen führenden Turmportal in Form eines
dekorativen Terrakottamaßwerks auf eingebranntem blaugrauen Grunde mit
einem das Bogenfeld füllenden Wappen aus Majolika erhalten.
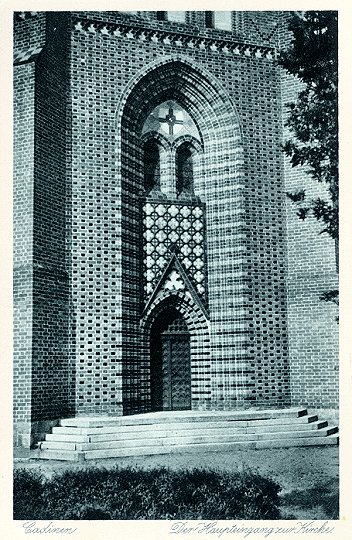
Bild
85: Der
Haupteingang zur Kirche
Die
Fußböden haben durchweg einen Belag von roten, mit eingepresstem
Ornament verzierten Platten erhalten, deren Flächen durch glasierte
Schichten in Felde geteilt wurden und besonders im Altarraum reiche
farbige Muster bildeten. Hervorzuheben ist, dass sämtliches Steinmaterial
einschließlich der Glasuren und der Fußbodenplatten in der
Kaiserlichen Ziegelei und Majolikafabrik hergestellt worden ist.
Besonders bemerkenswert ist ein dreiteiliges Maßwerk im Treppenraum,
welches auf Anregung des Kaisers aus gebranntem Ton hergestellt ist, wie
überhaupt das Interesse des Hohen Bauherrn sich auch während des
Krieges auf alle Einzelheiten der Bauausführung erstreckte.
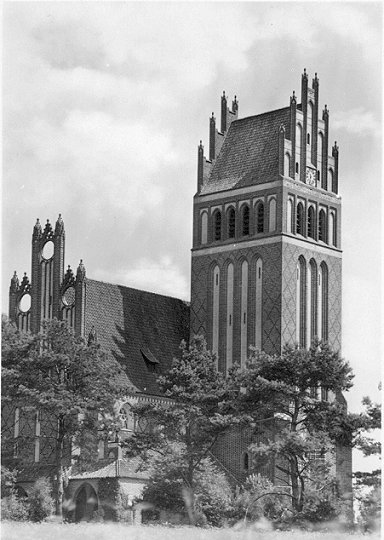
Bild 86
Allerdings musste dann kriegsbedingt die Einweihung
immer wieder verschoben werden, da der Kaiser anderes zu tun hatte.
Deshalb wurde die Kirche erst nach dem Ersten Weltkrieg (1920) und nun
doch in Abwesenheit des Bauherrn eingeweiht werden. Zu dieser Zeit
befand er sich nämlich schon in seinem niederländischen Exil in
Amerongen.

Am
10. August 1943 heirateten Margot geborene Liedtke und Rudolf Wolf in
der Cadiner Kirche (Bild 87). Sie wurden vom Berliner Domprediger Doehring
getraut. Der Geistliche war nämlich nach Cadinen gekommen, um die
jüngste Tochter von Louis Ferdinand und Kira von Preußen zu taufen.
Margot Liedtke war in Cadinen gut bekannt, denn ihr Vater gehörte zu den
ersten Mitarbeitern der vom deutschen Kaiser Wilhelm II. gegründeten
Cadiner Majolika und war zuletzt als Obermaler tätig.
Die Kirche war 1945 nur gering beschädigt und wurde leider
1957 abgerissen. Zum Glück ist der Altar erhalten geblieben. Er erhielt
vor einigen Jahren in der Nordwestecke des nördlichen Kirchenschiffes
von St. Nikolai in Elbing einen guten Platz.
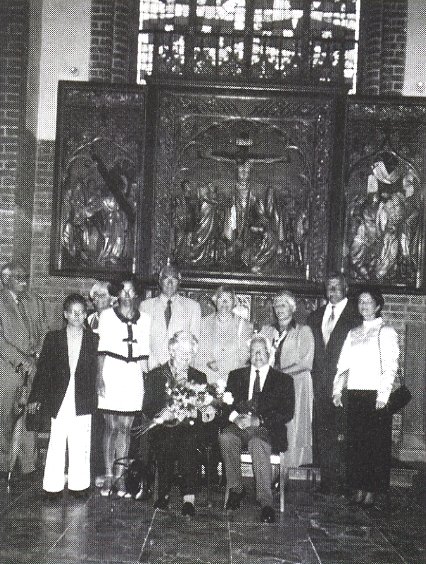
Das Hochzeitsfoto
vor dem Cadiner Altar in St. Nikolai in Elbing, am Freitag, dem 20. Juni
2003, anlässlich der Diamantenen Hochzeit von Margot und Rudolf Wolf
(Bild 88).

Bild 89: Der Cadiner Altar in der Nikolaikirche in Elbing
Teil 5 oder
Index
Copyright Christa Mühleisen
|