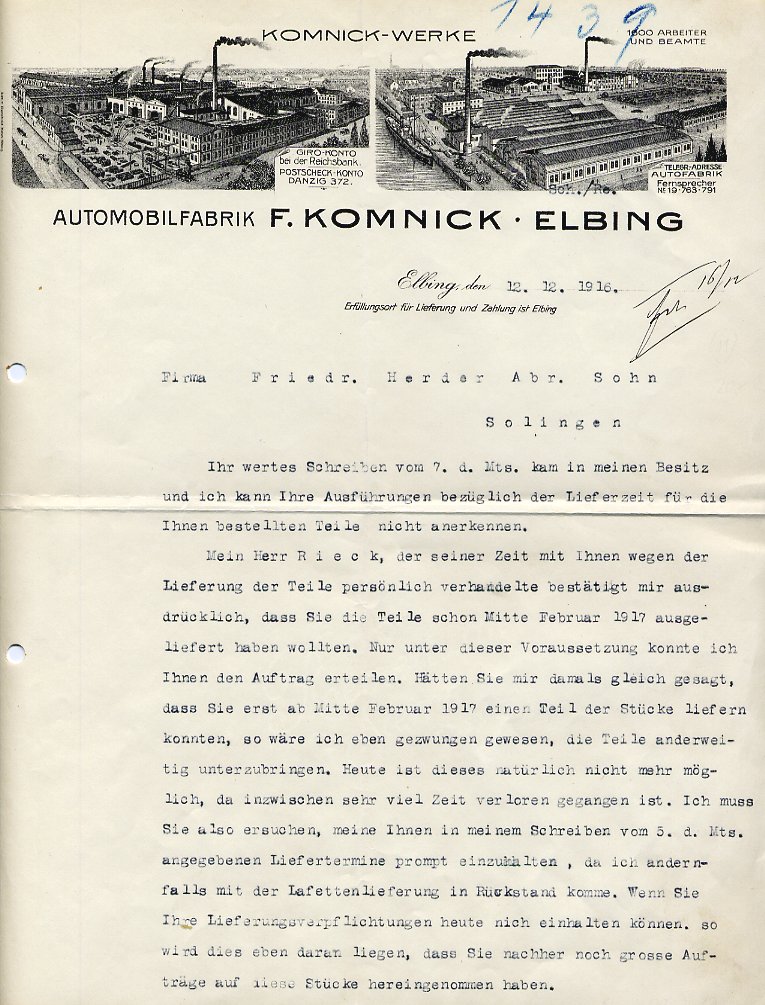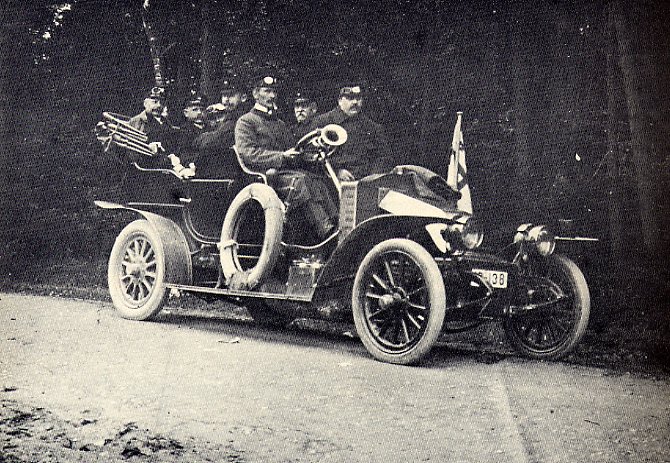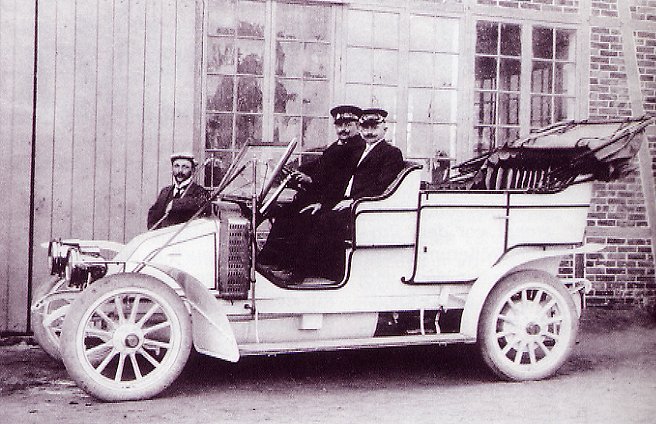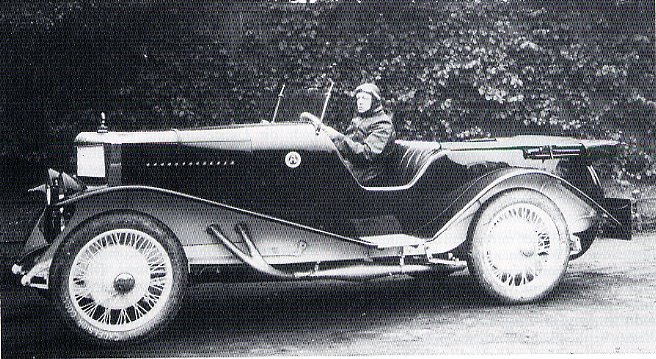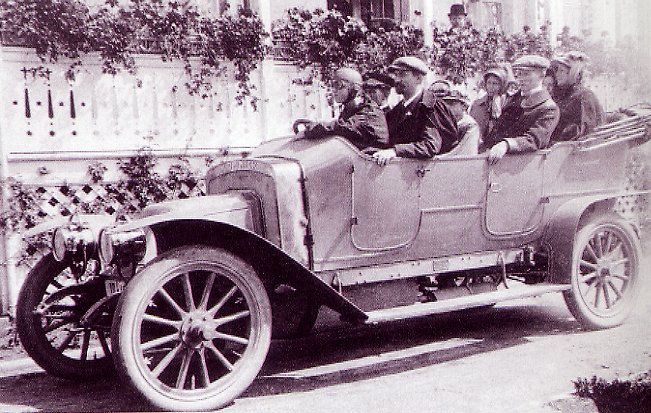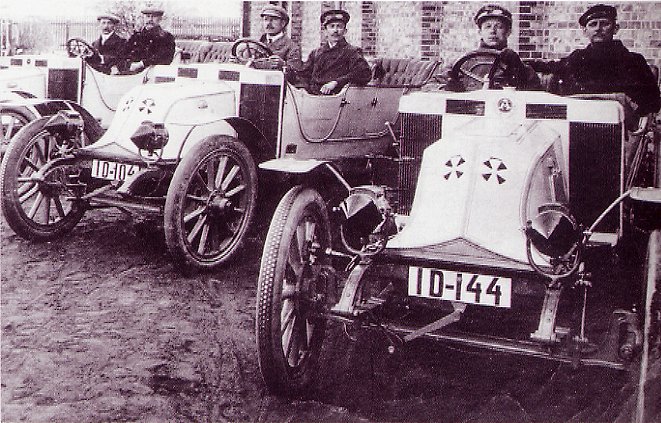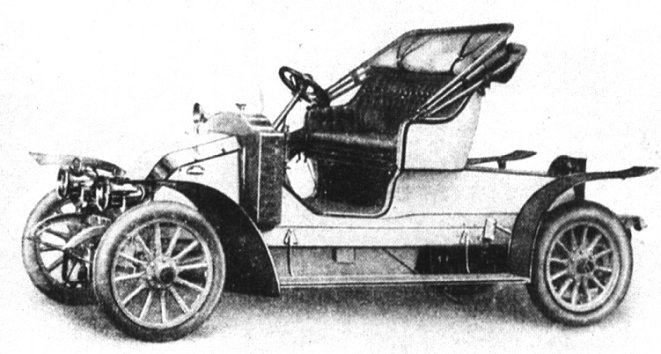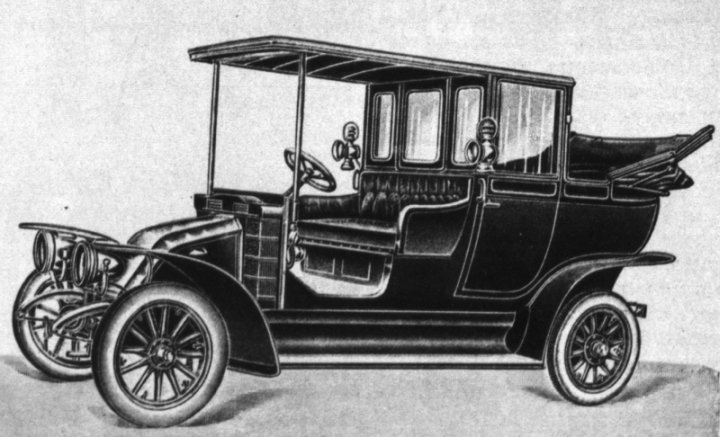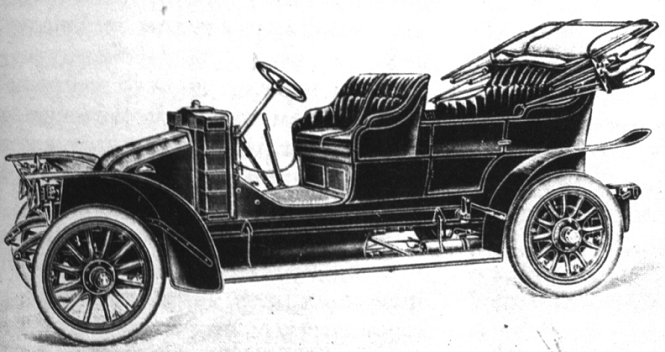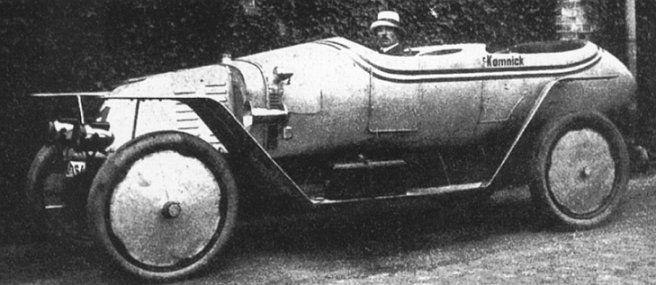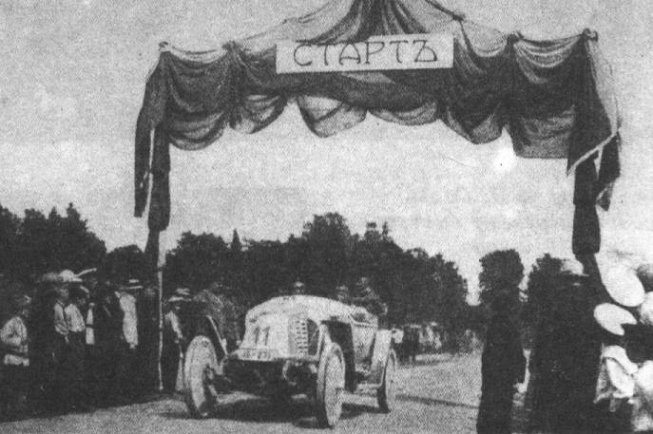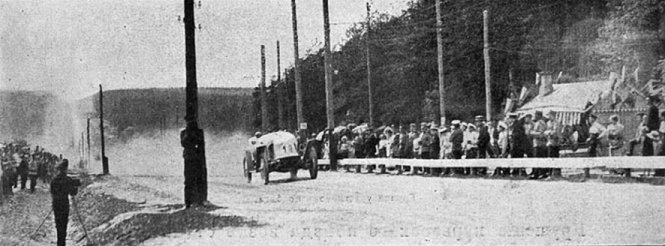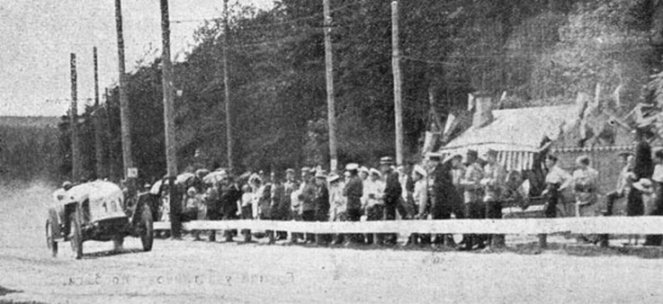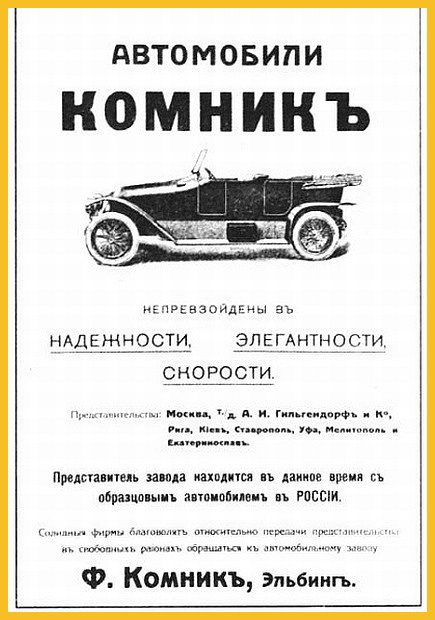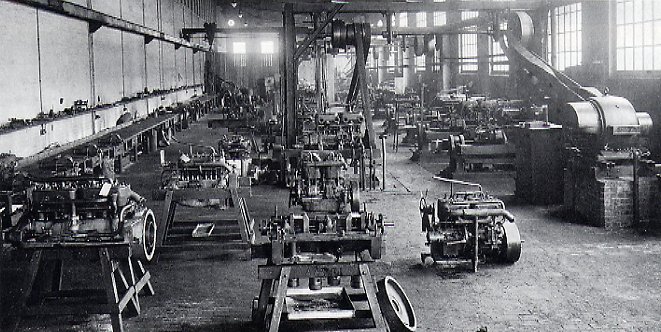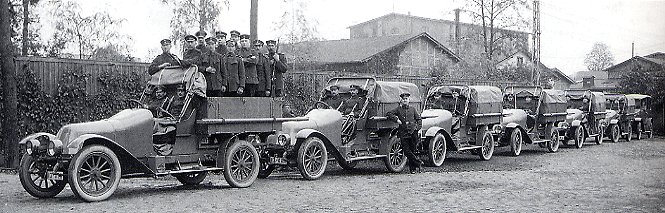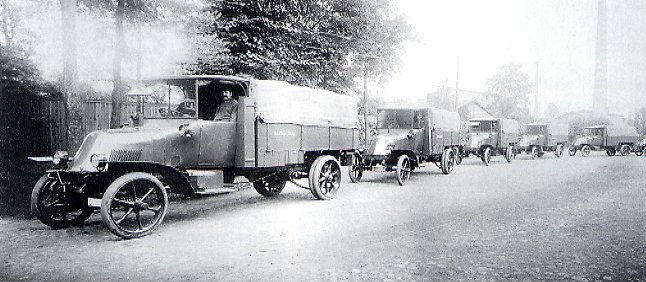|
2.Teil: Die ersten Automobile (ab 1906), Erster Weltkrieg
(1914-1918)
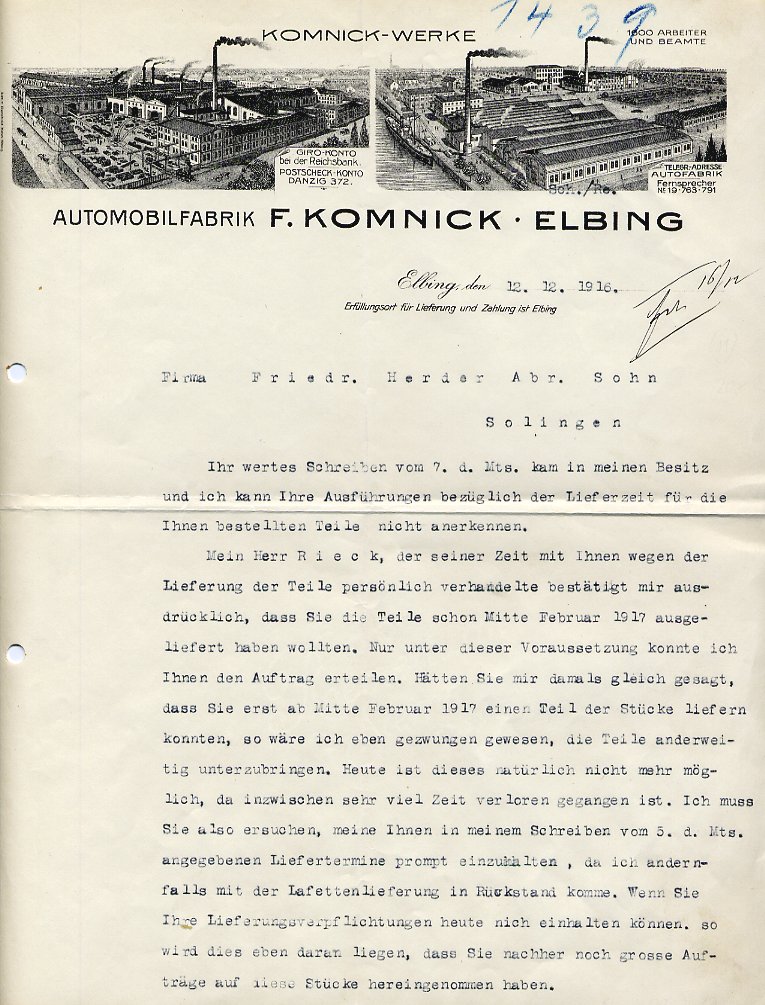
Bild 8: Firmenbrief von 1916

Bild 9:
alte Ansichtskarte von 1916
Diese Karte wurde am 5.8.1916 gestempelt. Auf der linken Seite sieht man das
Hotel de Berlin, daneben das Kaiserliche Postamt und auf der rechten Seite
ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu sehen. Links vorne steht ein Auto der Firma
Komnick.
1906 kaufte Franz Komnick von der ehemaligen Leinen-Industrie AG am Elbingfluß
ein rund 100000 qm großes Industriegelände, um eine Automobilfabrik zu bauen.
Die nächsten Automobilfabriken lagen 600 km von Elbing entfernt in Berlin und Stettin. Dies sollte bis 1945 so bleiben.
Bereits 1907
wurden die ersten PKW gebaut und ab 1908 das Programm durch die Produktion eines
Tragpfluges (auch Kraft- oder Motorpflug genannt) erweitert.
Der
"Komnick-Wagen" war bis etwa 1915 unter den deutschen Fabrikaten der einzige,
der wie der französische Renault den Kühler hinter dem Motor hatte.
Komnick erreichte damit, neben einem besseren Zugang zum Motor, eine
geringere Staubaufwirbelung durch den Kühlventilator. Außerdem konnte
die Kühlerhaube schnittiger gestaltet werden, als dies bei damaligen
Konkurrenzprodukten der Fall war. Die Wagen
fanden auch gleich guten Absatz, vor allem in Königsberg, Danzig und
Elbing. So waren z. Bsp. auch die ersten Königsberger Autodroschken
Elbinger Erzeugnisse.
Alle PKW hatten Reihenmotoren mit vier Zylindern
und, zunächst noch mit Konuskupplung ausgerüstet, Vierganggetriebe. Die
Kraft des Motors wurde über eine Kardanwelle auf die Hinterachse
übertragen.
Schließlich hatten
die umfangreichen Anlagen der Automobilfabrik die Errichtung einer Lokomotiv
-
Reparaturwerkstätte ermöglicht. Die erforderlichen Einrichtungen, wie schwere
elektrische Laufkräne von 70 t Tragfähigkeit zum Heben und Transportieren der
schwersten Lokomotiven und eine 20 m große Lokomotivdrehscheibe usw., waren
vorhanden.
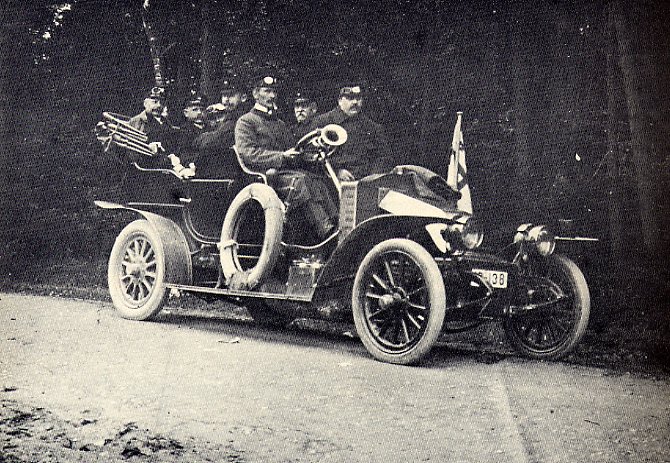
Bild 10: das erste Elbinger Auto
Großes Aufsehen erregte dieses Ungetüm, das im Jahre 1906 als
erstes
Elbinger Auto über holprige Landstraßen nach Königsberg schnaufte. Etwa drei
Stunden Fahrzeit brauchte man damals für diesen luftigen Ausflug. Besitzer des Wagens war Herr
Westenberge. Überall, wo das Gefährt auftauchte, wurde es als der Kraftwagen
des deutschen Kronprinzen, der damals sehr häufig mit einem ähnlichen Fahrzeug
nach Ostpreußen kam, umjubelt.
Der Komnick-Wagen gewann bald Ansehen und Freunde. Aus Qualitätsgründen und um
vom Verkehrsweg unabhängig zu sein, wurde möglichst alles selbst
hergestellt. Ihre Zuverlässigkeit bewiesen sie zuerst auf den beiden vom
Kaiserlichen Automobilklub veranstalteten Prinz-Heinrich- Fahrten 1907 und 1908.
Der eine der drei Wagen mit dem
10/30-Vierzylinder-Motor wurde von dem ältesten Sohn, dem in Danzig
studierenden Bruno Komnick gesteuert.
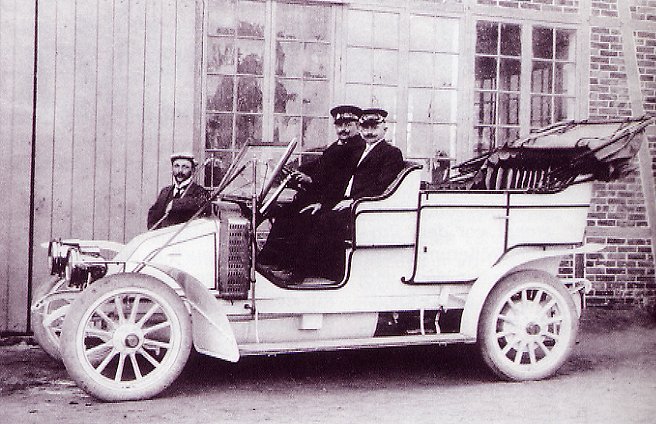
Bild 11: Ein Komnick 14/30 PS als Ausstellungsfahrzeug 1908
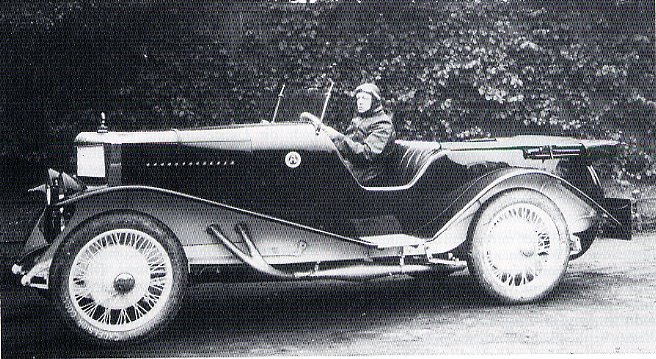
Bild 12:
Der Rote Teufel: Otto Komnick mit seinem Rennwagen
Diejenigen Söhne des Firmeninhabers, die ihrem Alter nach dazu in der Lage
waren, durchbrausten bereits in den Anfangszeiten der väterlichen
Autofabrikation die Stadt Elbing mit 30 oder 40 Stundenkilometern.
Besonders schlimm trieb es der Sohn Otto Komnick (Bild oben), der Rennfahrer und
das "enfant terrible" der Familie Komnick. Einmal raste er mit seinem
roten Flitzer (Roter Teufel genannt) im Vogelsang die Freitreppe hinauf, mitten
ins Café hinein, so daß sich die Gäste mit einem Sprung in Sicherheit bringen
mußten. Schließlich riß seinem Vater der Geduldsfaden und er warf Sohn Otto
hinaus. Dieser wanderte dann vor dem Ersten Weltkrieg in die USA aus.
Im
September 1910 fanden südlich von Elbing (bei Rogehnen) die großen
Kaisermanöver statt. Mit der Anwesenheit des Kaisers in einer Provinz waren
nach altem preußischem Brauch in der Regel Ehrungen bedeutender Männer des
betreffenden Landesteiles verbunden, und so empfing Franz Komnick zu seiner
großen Überraschung damals für seine Verdienste um die Industrialisierung
des deutschen Ostens von Kaiser Wilhelm II. die Ernennung zum Königl. Preußischen
Kommerzienrat. 1908 war ihm schon der Kronen-Orden verliehen worden.
Wenige
Tage nach der Ernennung zum Königl. Pr. Kommerzienrat wurde ihm durch die
Heirat seiner ältesten Tochter Elise die häusliche Würde eines
Schwiegervaters zuteil. Bei dieser groß angelegten Festlichkeit trat am
Polterabend eigentlich zum ersten Male das neu eingerichtete Wohnhaus auf dem Fischervorberg
vor den zahlreichen Gästen in Erscheinung. An einem Fabrikfest am Tage nach
der Hochzeit nahm die ganze Belegschaft von mehr als 2000 Mann mit ihren
Familien teil.
Franz Komnick und seine Frau waren die aufmerksamsten Gastgeber, die man sich
nur vorstellen konnte. Einige Persönlichkeiten, die im Hause Komnick verkehrten
waren: die beiden Ärzte Dr. Neusitzer und Dr. Graffunder, Oberbürgermeister
Dr. Merten, für dessen Berufung aus Posen sich Franz Komnick als
Stadtverordneter sehr eingesetzt hatte, die Pfarrer der Kirche zu den Heiligen
Drei Königen, Geheimrat von Etzdorff, der Verwalter des Kaiserlichen Gutes
Cadinen, Direktor Björkegren von den Städtischen Werken, Medizinalrat Dr.
Richter, Stadtforstrat Schroeder, seit 1912 Reichtagsabgeordneter, Direktor
Maurenbrecher, der Leiter des Elbinger Stadttheaters, Syndikus Dr. v. Rüts
und
manche andere.
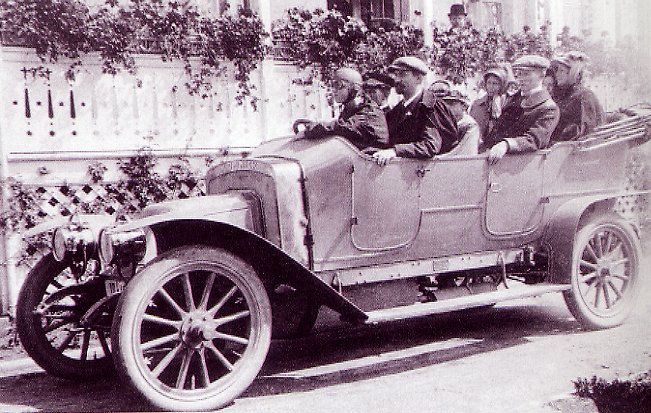
Bild
13: Mit 18 PS ließen sich um 1910 neun Personen bewegen
Das Jahr 1910 brachte die mit einer Schnelligkeitsprüfung verbundene
Riga-Fahrt des Ostdeutschen - Automobilklubs und das nächste Jahr die große
russische Kaiserpreisfahrt St. Petersburg - Sewastopol über mehrere tausend
Kilometer quer durch das russische Reich mit seinen zum Teil recht schlechten
Straßen. Auch hierbei schnitten die beiden 17/50 PS Komnick-Wagen, deren
einer wiederum von Bruno Komnick gesteuert wurde, sehr gut ab.
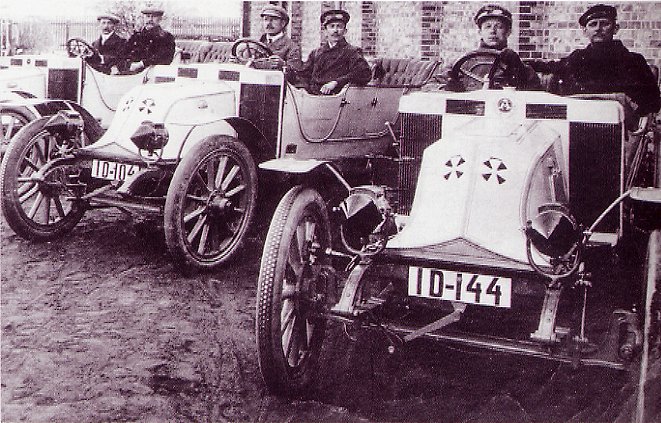
Bild
14: 17/50 PS - Komnick bei der Fernfahrt Petersburg - Sewastopol
Franz Komnick
konnte nach ihrer Rückkehr neben den sehr wertvollen Städtepreisen von Riga
und Reval vor allem den offiziellen Kaiserpreis in Empfang nehmen,
den die Wagen in ihrer Klasse errungen hatten. Noch einmal war der jungen
Fabrik kurz vor dem Krieg ein großer Erfolg in Rußland beschieden, und zwar
auf der großen St. Petersburger Jubiläums-Ausstellung zu Ehren des
300jährigen Bestehens des Zarengeschlechtes Romanow. Als Franz Komnick mit
seiner Gattin in der russischen Hauptstadt weilte, erlebte er die Genugtuung,
daß seinem Motorpflug bei einer internationalen Leistungsprüfung die Große
Goldene Staatsmedaille zuerkannt wurde.

Bild 15:
Komnick-Werbung für Motorpflüge
Die folgenden Bilder (Nr. 16-24) wurden von Stanislav Kiriletz zur
Verfügung gestellt. Sie stammen von der zeitgenössischen russischen Presse
aus den Jahren 1908 -1913.
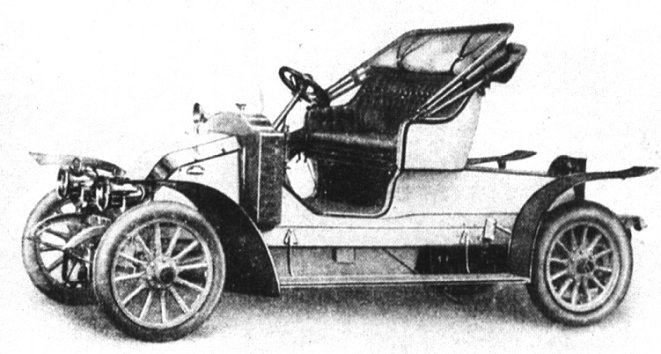
Bild 16: Komnick 6-18 PS 1908 Cabrio S.P.B.
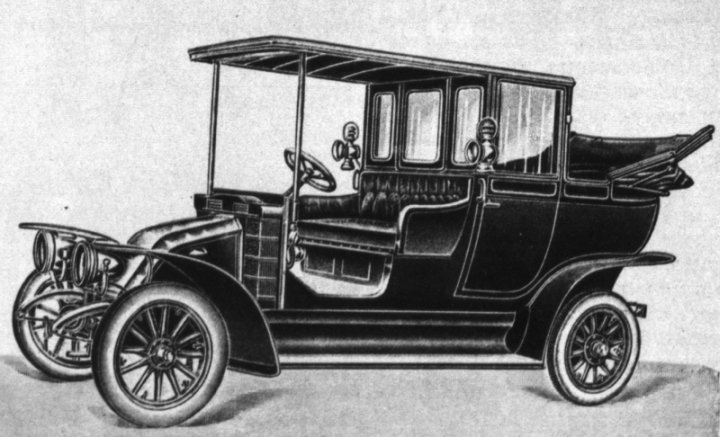
Bild 17:
Komnick 6-18 PS 1909 Landaulet S.P.B
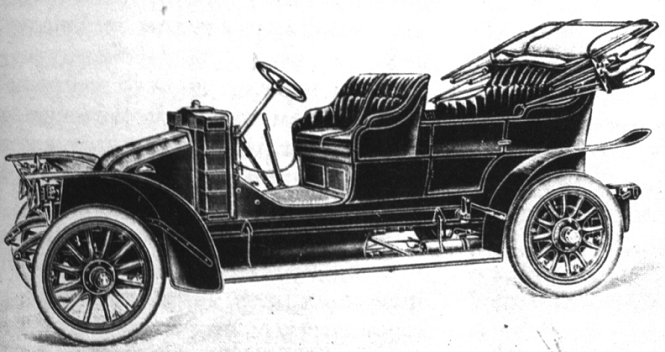
Bild 18:
Komnick 6-18 PS 1909 Doppelphaeton S.P.B
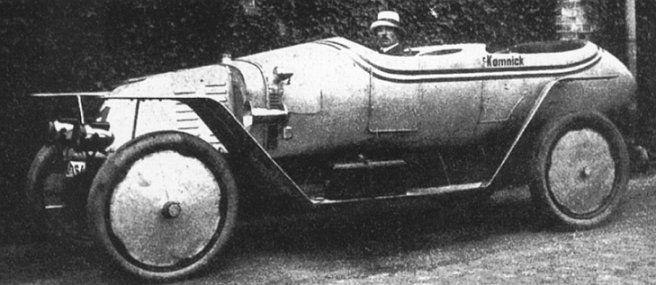
Bild 19:
Komnick 17-50 PS 1911 Torpedo
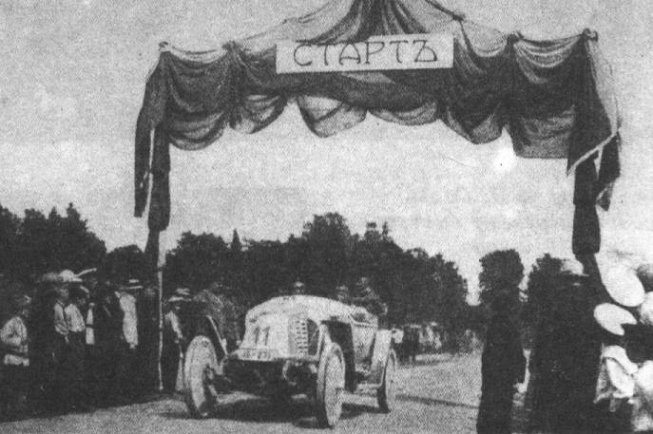
Bild 20:
Komnick 17-50 PS Reval 1911 Lucke

Bild
21:
Komnick 22-60 PS Moskau - Jaroslawl 1913 R. Winkler
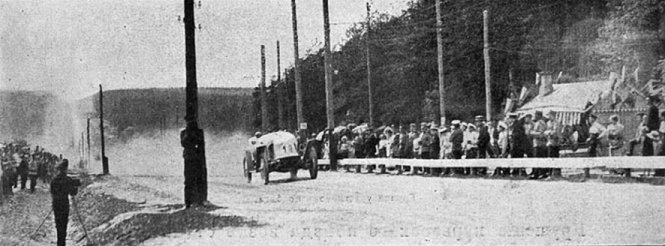
Bild 22: Komnick 17-50 PS S.P.B - Kiev 1913
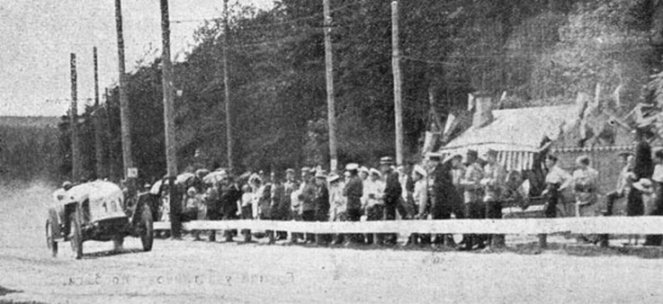
Bild 23: Komnick 17-50 PS S.P.B - Kiev 1913
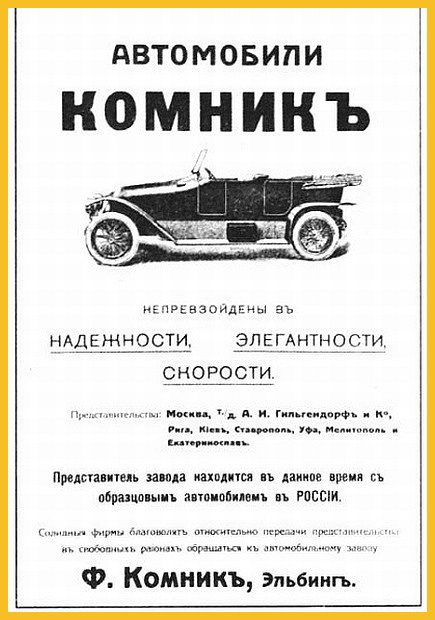
Bild 24: Komnickwerbung Hilgendorf
Als wichtigste Ergänzung zur Automobilfabrik hatte Franz
Komnick auf dem aufgeschütteten Gelände der Roßwiesen eine Stahlgießerei
errichtet, die mit den modernsten Bessemer-Öfen ausgestattet war und
mit ihren Hallen einen Flächenraum von 5000 Quadratmetern bedeckte.
Es war die größte Stahlgießerei Ostdeutschlands und Elbing
besaß die einzige Automobilfabrik in ganz Deutschland, die über ihr
eigenes Stahlwerk verfügte. Hier wurde nicht nur für die eigenen Werke
produziert, sondern auch für viele Automobilfabriken in
Mitteldeutschland. Außerdem wurden große und schwere Stücke für die
ostdeutsche Industrie hergestellt.
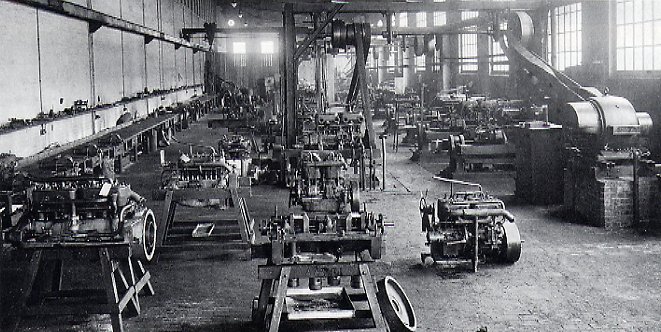
Bild
25: So sah der Serienbau von Motoren bei Komnick vor Kriegsbeginn aus.
Zu
einer abermaligen Ausweitung der Komnick-Werke kam es, als in Danzig die
Goßlerschen Gründungen, ein auf der Holm-Insel angesiedeltes , großes
Eisenwalzwerk, zum Verkauf standen und von Franz Komnick erworben
wurden. Zu
Kriegszeiten wurden hier nur Methylalkohol aus Holzabfällen (hauptsächlich Sägemehl)
und aus dem gleichen Material Schmieröl hergestellt.
Als in den ersten Augusttagen des Schicksalsjahres 1914 der Erste Weltkrieg
begann, war F. Komnick so gut wie allein in seinem Elbinger Haus. Seine Gattin
weilte mit der jüngsten Tochter Charlotte in den Vereinigten Staaten zum
Besuch des Sohnes Otto, der dort nach Beendigung seiner einjährigen
Militärdienstzeit in der amerikanischen Industrie tätig war.
Der älteste
Sohn Bruno mußte ebenso wie der Schwiegersohn Komnicks vom ersten Tag an ins
Feld.
Bald wurde die Lage des Landes östlich der Weichsel kritisch; viel
hätte nicht gefehlt, so wären die Nogat- und Weichseldämme durchstoßen
worden, um für die geplante Verteidigung der Weichsel ein Vorfeld-Hindernis
zu schaffen. Franz Komnick ließ wichtige Akten, Zeichnungen,
Geschäftspapiere und besonders wertvolle Modelle auf Lastkraftwagen
verpacken, um sie über die Weichsel zu schaffen und in Sicherheit zu bringen.
Doch kam es glücklicherweise durch den Sieg des Generalfeldmarschalls von
Hindenburg in der Schlacht bei Tannenberg nicht zu einer russischen Besetzung
Elbings.
Als Franz Komnick hörte, daß in den heißen Augusttagen 1914
unsere in Ostpreußen kämpfenden Truppen, vor allem die
Feldflieger-Einheiten, sehr unter dem Mangel an schnellen, motorisierten
Fahrzeugen litten, ließ er an sämtlichen bereits hergestellten PKW in Tag-
und Nachtarbeit die Karosserien hinter den Führersitzen absägen. Die
Aufbauten wurden entfernt, eine Pritsche mit Plane und Spriegel kam an deren
Stelle, und die Fahrkabine erhielt ein Faltdach. Nach Ausstattung der
Fahrzeuge mit Luftbereifung und Verstärkung der Federn konnte so in
kürzester Zeit eine große Anzahl von 1/2 t Behelfswagen der nahen Front
zugeführt werden. Dort wurde jedes dieser Fahrzeuge mit großer Freude
begrüßt.
Durch diese Umbaumaßnahmen konnte Franz
Komnick noch zahlreiche, bereits fertiggestellte Personenwagen an den Mann
bringen, da auf Anweisung aus Berlin im Elbinger Werk keine Pkw, sonder nur
noch Lkw hergestellt werden durften. Die Behelfstransporter müssen als Beginn der Nutzfahrzeugfertigung
bei Komnick betrachtet werden.
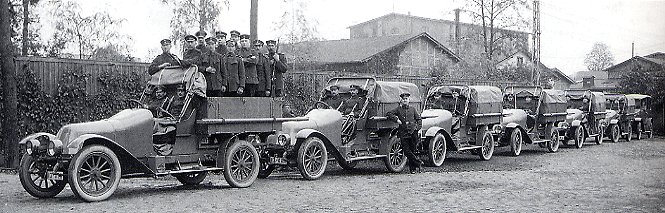
Bild
26: Bei Kriegsausbruch zu Behelfslastwagen umgebaut: Pkw des Typs 17/50.
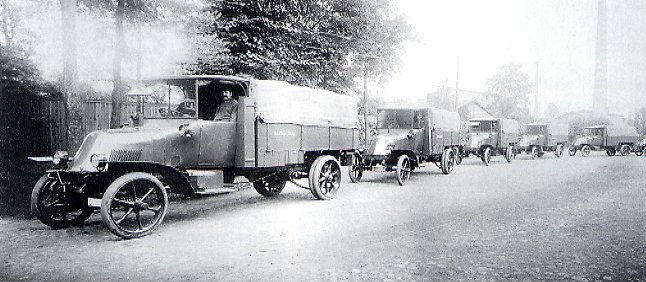
Bild
27: Auch bei den ersten Lkw befand sich der Kühler noch hinter dem Motor.
Die
ersten richtigen Komnick-Nutzfahrzeuge waren Dreitonner mit
Stahlgußspeichenrädern und Vollgummibereifung. Streng nach den Vorgaben der
Heeresverwaltung mußten alle Lastwagen mit Kettenantrieb ausgerüstet werden.
Mit ihrer aus dem Pkw-Bau übernommenen, windschnittigen Motorhaube, die zum
Zwecke der besseren Kühlung des Motors jetzt mit Luftschlitzen versehen war,
erhielten die Komnick-Lkw ein charakteristisches Aussehen. Der hinter dem
Motor angeordnete Ventilator fungierte gleichzeitig auch als Schwungrad.

Bild
28: Dreitonner-Lastwagen vor Ablieferung an die Reichswehr

Bild
29: Mit Bajonett und Pickelhaube: Komnick-Lastwagen im Fronteinsatz.

Bild
30: Auslieferung der ersten kardangetriebenen Lkw an die Reichswehr.
Bei
den nächsten Ausführungen mußte allerdings zugunsten eines konventionell
vor dem Motor stehenden Kühlers auf das typische Erscheinungsbild verzichtet
werden. Die an ihrem oberen Rand abgerundeten Kühlermasken trugen jetzt
deutlich sichtbar den Komnick-Schriftzug. Von Beginn an verfügten alle
serienmäßig hergestellten Komnick-Lkw über ein festes Dach über dem
Führersitz und eine linksseitig angebaute Tür. Die bei den Nutzfahrzeugen
verwendeten Vierzylinder-Vergasermotoren waren in robuster
Zweiblockausführung konzipiert worden. Dem Dreitonner war zwischenzeitlich
ein Fünftonner zur Seite gestellt worden, der allerdings trotz erheblich
gestiegener Nutzlast mit dem gleichen Vierzylinder-Triebwerk auskommen mußte.

Bild
31: Dreitonner aus der zweiten Serien mit Kühler vor dem Motor

Bild
32: Der Bremser immer dabei: Fünftonner mit Komnick-Anhänger.
In der Maschinenfabrik wurde viel Heeresgerät aller Art
angefertigt, u. a. auch Fahrzeuge für pferdebespannte Formationen. Außerdem
wurde eine große Anzahl von Kraftpflügen hergestellt und an die
Heeresverwaltung geliefert, die an der Front zur Landbestellung in besetzten
Gebieten und als Zugmaschinen zum Einsatz kamen. In beiden Fabriken fanden auf
diese Weise mehr als 3000 Beschäftigte eine Anstellung.
Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) wurde die Produktion mit Hilfe von etwa 800
französischen, belgischen und russischen Kriegsgefangenen aufrecht erhalten,
die den Fabriken zugewiesen und dort in mustergültigen Räumen untergebracht
und verpflegt wurden.
Nachdem Danzig aufgrund der Ereignisse des Ersten
Weltkriegs zum Freistaat erklärt worden war, verlegte Franz Komnick die
Produktion des Danziger Walzwerks (ehemaligen Goßlersche Gründungen) nach
Elbing. Mit
Hilfe der Kriegsgefangenen wurde also 1914/15 die große frühere
Walzenstraßenhalle in der Elbinger Automobilfabrik
aufgerichtet. Es war die sogenannte Hindenburghalle, in der später auch
Konzerte für die Belegschaft und Versammlungen stattfanden. Abgesehen von
kleineren Werken und Reparaturniederlassungen (z. B. auch in Rußland)
befanden sich sämtliche wichtigen Produktionsstätten in Elbing.
Für die Automobilfabrik erwies sich die Stahlgießerei als
besonders wertvoll, weil dort unzählige Granaten gegossen werden
konnten.
Die firmeneigene Stromversorgung war von 1915-1927 in Betrieb.
Zeitweise wurde
auch ein großer Teil von Elbing mit Komnickstrom versorgt. Sonst wurde der
Strom vom "Ostpreußenwerk" bezogen.
Bild 33: Mein Großvater, der Maschinist
Johannes Kapitzke (geb. am 10.3.1893) war vom 28.11.1918 - 1.10.1920 als
Maschinenschlosser beim Aufbau der Maschinen in der Elektrischen
Zentrale in der Automobilfabrik Komnick tätig.
Vom 1.10.1920 - 31.5.1923 war er als
Maschinist in der Abteilung Kraftzentrale beschäftigt. Hier war er für
die Wartung einer stehenden Verbund-Dampfmaschine von 1 500 PS -
Leistung und allen damit in Zusammenhangstehenden Arbeiten
verantwortlich.
|
 |
3. Teil oder Index
12.05.05 -b-
|